Professor Dr. Oliver A. Cornely, Direktor des Instituts für Translationale Forschung am CECAD-Exzellenzcluster sowie wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Klinische Studien (ZKS) Köln an der Uniklinik Köln und der Medizinischen Fakultät, wurde mit dem Dr. Gerald P. Bodey, Sr., Memorial Distinguished Visiting Professorship Award des MD Anderson Cancer Center in Houston, Texas, ausgezeichnet. Der nach dem US-amerikanischen Onkologen und Infektiologen Dr. Gerald P. Bodey (1934–2020) benannte Preis zählt zu den renommiertesten wissenschaftlichen Auszeichnungen des Gebiets und würdigt herausragende Beiträge in Forschung und Lehre.
Auszeichnungen und Ehrenämter
Professor Oliver Cornely

Professorin Barbara Dauner-Lieb

Prof. Dr. Dr. h.c. Barbara Dauner-Lieb, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht und Europäische Privatrechtsentwicklung, Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen, wurde am 4. Juni mit der Würde einer Ehrensenatorin ausgezeichnet.
Professor Johannes Vogt

Mit dem Best Publication Award 2024 der Anatomischen Gesellschaft ausgezeichnet wurde kürzlich die Forschungsgruppe um Prof. Dr. Johannes Vogt vom Institut für Anatomie II, AG Molekulare und Translationale Neurowissenschaften der Medizinischen Fakultät der Universität zu Köln sowie die beteiligten Forschenden für die in Molecular Psychiatry im November 2024 veröffentlichte Publikation Altered cortical synaptic lipid signaling leads to intermediate phenotypes of mental disorders.
Die Studie beschreibt einen Zusammenhang zwischen synaptischen Lipidsignalen im Gehirn und psychischen Erkrankungen: Teams um Professor Dr. med. Johannes Vogt und Professor Dr. med. Dr. phil. Robert Nitsch (equally contributing last author der Studie) am Institut für Translationale Neurowissenschaften der Universität Münster untersuchten die Rolle des Enzyms Autotaxin und dessen Gegenspieler, das Protein PRG-1, in der Regulierung des Gleichgewichts zwischen Erregung und Hemmung in den Gehirnen von Menschen und Mäusen. Sie konnten nachweisen, dass eine im Menschen identifizierte genetische Störung zur Erhöhung von bioaktiven körpereigenen Fetten im Gehirn führt, was ein Ungleichgewicht zwischen Erregung und Hemmung in Gehirnschaltkreisen zur Folge hat und beispielsweise Depression, Ängste und erhöhte Stressanfälligkeit begünstigt. Die Behandlung mit einem Enzymhemmer, der die Aktivierung der Fette unterbindet, kann das Gleichgewicht jedoch wiederherstellen und die Symptome lindern. Die Untersuchungen wurden im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 1451 „Schlüsselmechanismen normaler und krankheitsbedingt gestörter motorischer Kontrolle“ durchgeführt.
Professor Florian Klein

Professor Dr. Florian Klein, Direktor des Instituts für Virologie der Uniklinik Köln, ist als neues Mitglied in die Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften berufen worden. Die Aufnahme in die älteste Gelehrtengesellschaft gilt als besondere Auszeichnung für wissenschaftliche Exzellenz und würdigt die herausragenden Beiträge des Mediziners zur virologischen und immunologischen Infektionsforschung.
Die 1652 gegründete Leopoldina vereinigt rund 1.600 Forschende aus nahezu allen Wissenschaftsbereichen und aus über dreißig Ländern zu einer klassischen Gelehrtengesellschaft. Die Mitglieder werden in einem mehrstufigen Auswahlverfahren in die Akademie gewählt. Kriterium für die Aufnahme sind herausragende wissenschaftliche Leistungen.
Michael Ostrzyga

Michael Ostrzyga, Universitätsmusikdirektor, Institut für Musikwissenschaften, erhält den erstmals vergebenen Chorpreis der GEMA-Stiftung. Der Preis würdigt Ostrzygas bedeutendes und vielfältiges Wirken in der aktuellen Chormusik. Die Preisverleihung findet am 1. Juni 2025 im Rahmen des Deutschen Chorfests in Nürnberg statt, bei dem der Preisträger die Auszeichnung persönlich entgegennehmen wird. Der Chorpreis wird alle vier Jahre vergeben und würdigt Komponistinnen und Komponisten, die diesen Bereich durch ihre Arbeit prägen.
Professor Oliver Cornely

Professor Dr. Oliver Cornely, Institut für Translationale Foschung (CECAD), wurde zum neuen Präsidenten der International Society for Human and Animal Mycology (ISHAM) gewählt.
Dr. Christina Vollmert-Boldt

Dr. Christina Vollmert-Boldt, Department Kunst und Musik, wurde für ihr Dissertationsprojekt »Szenen bürgerlicher Festkultur. Theatrale Erfahrungsorte der Geschichte, nationaler Gemeinschaft und Technologie in Frankfurt a. M. um 1900« mit dem Max-Herrmann-Dissertationspreis 2024 der Gesellschaft für Theatergeschichte ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand am 23. November 2024 im Hörsaal des Instituts für Theaterwissenschaft der FU Berlin statt.
Besonders gefallen hat der Jury, dass die Untersuchung aus dem normalen Theaterbetrieb heraustritt und die theatrale Dimension großer Feste analysiert. Zustimmung fand auch die Kombination von Begrenzung und Erweiterung: Begrenzung auf eine Stadt und zugleich Erweiterung zu einem ganzen Spektrum unterschiedlichster Veranstaltungen, namentlich Historische Stadtfeste, Nationale Schützenfeste und Technikausstellungen. Darüber hinaus haben sich die Juroren über die Erschließung und Auswertung eines brachliegenden Archivbestands aus der Kölner Theaterwissenschaftlichen Sammlung gefreut. Dr. Vollmert-Boldt hatte bereits Anfang des Jahres 2024 für Ihre Dissertation den Johann-Philipp-von-Bethmann-Studienpreis der Frankfurter Historischen Kommission erhalten.
Professorin Nadine Oberste-Hetbleck

Professorin Dr. Nadine Oberste-Hetbleck, Direktorin des Zentralarchivs für deutsche und internationale Kunstmarktforschung (ZADIK), wurde am 1. Januar 2025 von den Mitgliedern der Klasse der Künste als neue Sekretarin gewählt. Sie folgt damit auf den renommierten Bildhauer und langjährigen Sekretar der Klasse Professor Dres. h.c. mult. Anthony Douglas Cragg. Mit Nadine Oberste-Hetbleck steht erstmals eine Frau an der Spitze dieses besonderen Zusammenschlusses aus Forschenden und Kunstschaffenden in der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste.
Die Kunstwissenschaftlerin leitet seit 2020 das ZADIK. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit dem Kunstmarkt in seinen unterschiedlichen Ausprägungen und Themen. Ihr wissenschaftliches Interesse erstreckt sich dabei nicht nur auf Marketingstrategien in Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch auf die Institutionen, Zusammenschlüsse und Akteure des privaten Kunstmarkts, des staatlichen Kulturbetriebs und der Zivilgesellschaft.
Oberste-Hetbleck ist seit 2021 Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Unterstützt wird sie in ihrer neuen Funktion als Sekretarin von dem Bildhauer Andreas Schmitten, der zum stellvertretenden Sekretar der Klasse der Künste gewählt wurde. Nadine Oberste-Hetbleck möchte gemeinsam mit Andreas Schmitten an die Aktivitäten von Tony Cragg und Mischa Kuball anknüpfen, die Akademie zu einem lebendigen Ort des Diskurses mit der Öffentlichkeit zu machen. Sie sieht in der verstärkten Vermittlung künstlerischer Positionen in unsere Gesellschaft eine große Chance, neue Perspektiven zu komplexen Themen aufzuzeigen und zu wertvollen Reflektionsprozessen anzuregen.
Seit 1970 bringt die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste die führenden Forschenden des Landes zusammen. Im Jahr 2008 öffnete sich die Gelehrten-Gemeinschaft zudem den Künsten. Die Nordrhein-Westfälische Akademie ist damit die erste und bisher einzige Wissenschaftsakademie, die die Künste als eigenständige Klasse integriert hat.
Dr. Anne Wolf

Dr. Anne Wolf, Nachwuchswissenschaftlerin am Lehrstuhl für Experimentelle Immunologie des Auges im Zentrum für Augenheilkunde der Uniklinik Köln, hat in diesem Jahr den Förderpreis der Freifrau von Nauendorf-Stiftung in Höhe von 10.000 Euro erhalten. Ziel des Preises ist die Unterstützung von Forschung, Diagnose und Therapie auf dem Gebiet der Netzhauterkrankungen. Die Stiftung wurde 2001 von der an AMD erblindeten Stifterin Anneliese Freifrau von Nauendorf in Wiesbaden gegründet.
Die Jury der Stiftung würdigt mit dem Preis Dr. Wolfs Arbeit zur Identifizierung mikroglialer Immunmechanismen und Zielstrukturen zur Optimierung von AAV-basierten Gentherapien bei Netzhautdegeneration. Bei einem Vortrag im Presseclub Wiesbaden stellte sie die Arbeit vor und nahm den Förderpreis entgegen.
Mit der Arbeit adressiert Wolf ein wichtiges und aktuelles Problem in der Behandlung auf Basis adeno-assoziierter Viren (AAV). AAV-Vektoren können im Auge unter bestimmten Voraussetzungen eine unerwünschte Immunreaktion und konsekutiv Entzündungsprozesse auslösen, die sich negativ auf den Behandlungseffekt auswirken. Vorläufige Daten der Kölner Arbeitsgruppe deuten darauf hin, dass residente Mikroglia-Zellen hier immunologisch eine entscheidende Rolle spielen. Dr. Wolf wird im Mausmodell eingehend untersuchen, welche Bedeutung den Mikroglia für die Immunreaktion nach lokaler AAV-Injektion zukommt. Diese systematische Analyse soll zu einem tieferen Verständnis der immunologischen Vorgänge am Auge führen und wichtige Erkenntnisse zur Weiterentwicklung der AAV-basierten Gentherapie beisteuern.
Dr. Dr. Philipp Schommers und Dr. Alexander Simonis

Zwei von drei Medaillen in Silber der Walter-Siegenthaler-Gesellschaft gehen in diesem Jahr an Privatdozent Dr. Dr. Philipp Schommers und Dr. Alexander Simonis, beide von der Klinik I für Innere Medizin der Uniklinik Köln und der Medizinischen Fakultät. Die Medaillen werden als Anerkennung für grundlegende wissenschaftliche Arbeiten zu aktuellen Themen der Inneren Medizin vergeben und wurden im Rahmen des 38. Symposiums der Gesellschaft Anfang November in Köln verliehen. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 2.000 Euro verbunden.
Dr. Schommers leitet das Labor für antivirale Immunität. Seine Forschungsgruppe konnte zeigen, dass die HIV-1 Neutralisationsaktivität und Langlebigkeit der natürlich gebildeten neutralisierenden Antikörper stark von der Menge an Virus im Patienten abhängt – in bekannter Analogie zur SARS-COV2-Infektion. Sie charakterisierten HIV-1-infizierte Menschen, die eine höchst potente und breit neutralisierende Antikörperantwort entwickelten, die auch nach vielen Jahren noch nachweisbar war. Dies eröffnet die Aussicht, einen HIV-1-Impfstoff zu entwickeln, der eine solche langlebige Antikörperantwort in den Geimpften induziert.
Dr. Simonis leitet das Labor für translationale Infektionsimmunologie. Er hat mit seinem Team einen neuartigen Ansatz der Antibiotika-unabhängigen Blockade von Virulenzfaktoren des Krankenhauskeims Pseudomonas aeruginosa entdeckt. Diese Bakterien können lebensbedrohliche Lungen-, Nieren- und Blutstromerkrankungen verursachen und sind aufgrund zahlreicher Resistenzmechanismen gefürchtet. Um dieser wachsenden Bedrohung durch antimikrobielle Resistenzen entgegenzutreten, werden dringend neue Therapieoptionen benötigt. In der ausgezeichneten Studie konnte gezeigt werden, dass die menschliche humorale Immunantwort für die Entwicklung von hochpotenten antibakteriellen Antikörpern genutzt werden kann, die herkömmliche Resistenzmechanismen umgehen. Humane monoklonale Antikörper könnten somit einen innovativen Therapieansatz insbesondere bei schweren Infektionen mit multiresistenten Bakterien bieten.
Dr. Jan Schmitz

Dr. Jan Schmitz, Leiter der Arbeitsgruppe »Notfallmedizin und Hypoxie in extremen Situationen« in der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin der Uniklinik Köln und der Medizinischen Fakultät, ist auf der 62. wissenschaftlichen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin (DGLRM) mit dem Rainer-Kowoll-Nachwuchspreis 2024 ausgezeichnet worden. Auf der Tagung präsentierte er seine Arbeiten zum Thema »Kardiopulmonale Wiederbelebung an Bord von Flugzeugen im Kontext hypobarer Hypoxie als Einflussfaktor auf die Qualität«.
Das Forschungsteam um Dr. Schmitz untersucht den Einfluss der rund zehn Kilometer Höhe während eines Linienflugs auf die Qualität der Herz-Kreislauf-Wiederbelebung. Durch eine Druckkabine, die es Piloten und Passagieren ermöglicht, sich in dieser Höhe aufzuhalten, sind die Umgebungsdrücke innerhalb des Flugzeugs so, als halte man sich auf der Zugspitze auf – auch dort ist die Luft »dünner« als am Boden. Dr. Schmitz konnte auf einem simulierten Flug innerhalb einer Druckkammer erstmalig nachweisen, dass sich die dünnere Luft nach sechs Stunden signifikant auf die Qualität einer Wiederbelebung auswirkt und somit der Ablauf von Wiederbelebungsmaßnahmen bei einem Herz-Kreislaufstillstand während eines Langstreckenflugs angepasst werden sollte. Die Reanimationsqualität hat einen wesentlichen Einfluss auf das primäre Überleben sowie die Langzeitprognose nach einem überlebten Herz-Kreislaufstillstand.
Dr. Christopher Gaisendrees

Dr. Christopher Gaisendrees von der Klinik und Poliklinik für Herzchirurgie im Herzzentrum der Uniklinik Köln und der Medizinischen Fakultät ist von der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik (DGfK) und der Deutschen Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) für seinen herausragenden wissenschaftlichen Beitrag auf der Jahrestagung »Fokustagung Herz« geehrt worden. Der renommierte, mit 1.000 Euro dotierte DGTHG-Preis wird jährlich für den besten ärztlichen Kongressbeitrag verliehen.
Die prämierte Arbeit von Dr. Gaisendrees basiert auf Forschungsarbeiten, die während seines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Postdoc-Aufenthalts im Jahr 2023 an der University of Minnesota in der Arbeitsgruppe von Professor Demetris Yannopoulos durchgeführt wurden. Im Fokus stand die Analyse physikalischer Belastungen, die während der Therapie mit einer veno-arteriellen ECMO (extrakorporale Membranoxygenierung) bei Patienten mit Herzkreislaufstillstand auftreten. Die komplexen Messungen wurden im Herzkatheterlabor durchgeführt und tragen dazu bei, ein tieferes Verständnis der Auswirkungen dieser lebensrettenden Therapie auf das Herz-Kreislaufsystem zu gewinnen.
Professor Dr. Bernhard Dorweiler

Professor Dr. Bernhard Dorweiler, Direktor der Klinik und Poliklinik für Gefäßchirurgie, Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie der Uniklinik Köln, ist zu Beginn des Jahres in den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG) berufen worden. In seiner neuen Funktion vertritt er die universitären Gefäßchirurginnen und Gefäßchirurgen in Deutschland.
Die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin wurde 1984 gegründet. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von über 10 Prozent ist sie eine der dynamischsten chirurgischen Fachgesellschaften in Deutschland, die aktuell mehr als 3.500 Gefäßchirurginnen und Gefäßchirurgen umfasst.
Dorweiler ist Gründungsmitglied der 2019 ins Leben gerufenen Kommission »Künstliche Intelligenz und digitale Transformation« und hat 2024 deren Leitung übernommen. Sein Engagement in der DGG erstreckt sich zudem auf die Kommission »Hygiene, Wunde und septische Gefäßchirurgie«, der er seit 2017 angehört, sowie die Kommission »Wissenschaft und Forschung«, in die er 2024 berufen wurde.
Mit seiner Expertise im Bereich digitaler Technologien und innovativer Behandlungsmethoden setzt sich der Mediziner maßgeblich für die Weiterentwicklung der akademischen Gefäßchirurgie und die Umsetzung zukunftsweisender Projekte sowie die Vernetzung der universitären Standorte ein.
Professor Dr. Claus Cursiefen

Professor Dr. Claus Cursiefen, Direktor des Zentrums für Augenheilkunde der Uniklinik Köln, wurde auf der 122. Jahrestagung der Deutschen Ophthalmologischen Gesellschaft (DOG) in Berlin für weitere vier Jahre zum Generalsekretär der Gesellschaft gewählt. Als Generalsekretär hat der renommierte Augenspezialist die Aufgabe, die Kontinuität der Arbeit der DOG in Grundsatzfragen zu wahren. Ihm obliegt federführend die Pflege der Kontakte zu anderen Verbänden und Gesellschaften, den Kammern und der öffentlichen Verwaltung. Cursiefen ist der vierte Generalsekretär in der Geschichte der Gesellschaft.
Claus Cursiefen wurde zudem vom Filatov Institut für Augenheilkunde der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine mit der Filatov-Gedächtnisvorlesung und der Filatov-Gedenkmedaille geehrt. Cursiefen erhält die Auszeichnung für seine Verdienste zur Optimierung der minimalinvasiven Hornhauttransplantation. Mit der Augenklinik des Filatov Instituts besteht seit Jahren ein enger klinischer und wissenschaftlicher Austausch
Professorin Dr. Ioanna Gouni-Berthold

Professorin Dr. Ioanna Gouni-Berthold, Leiterin der Lipidambulanz und der Studienambulanz für Fettstoffwechselstörungen in der Poliklinik für Endokrinologie, Diabetologie und Präventivmedizin der Uniklinik Köln, ist für den Zeitraum 2025 bis 2027 in den Vorstand der Internationalen Atherosklerose-Gesellschaft (IAS) wiedergewählt worden. Das ist eine besondere Auszeichnung, da sie zusammen mit einem italienischen Kollegen Europa im Vorstand der Fachgesellschaft vertritt. In ihrer Funktion will sie die Forschung über Entstehung und Behandlung der Atherosklerose fördern und dazu beitragen, dass dieses Wissen in eine bessere klinische Therapie von Patient*innen umgesetzt wird. Gouni-Berthold wird weltweite Projekte unterstützen und mitinitiieren, die auf die Schaffung von Konsensusleitlinien abzielen und Einblicke in spezielle Bevölkerungsgruppen mit besonderen Herausforderungen geben, wie zum Beispiel Patient*innen mit familiärer Hypercholesterinämie, Hypertrigliyzeridämie sowie mit erhöhtem Lipoprotein(a).
Dr. Othman Al-Sawaf

Dr. Othman Al-Sawaf, Klinik I für Innere Medizin, hat den Paul Martini Nachwuchspreis für Klinische Forschung erhalten, der im Rahmen des jährlichen Herbstsymposiums der Paul-Martini-Stiftung vergeben wurde. Der Preis ist mit 6.000 Euro Preisgeld verbunden und wird an Forschende vergeben, die nicht älter als 35 Jahre sind und herausragende Leistungen im Bereich der klinischen Forschung und klinischen Pharmakologie erbracht haben.
Dr. Al-Sawaf wurde mit dem Preis für seine wissenschaftlichen Arbeiten zur Richter-Transformation ausgezeichnet, die bei Patient*innen mit chronischer lymphatischer Leukämie (CLL) auftreten kann. In drei bis zehn Prozent der Fälle kann sich eine CLL in ein aggressives Lymphom wandeln, was als »Richter-Transformation« (RT) bezeichnet wird. Die Richter-Transformation (RT) ist eine hochaggressive Erkrankung, die durch konventionelle Chemotherapie nur selten erfolgreich behandelt werden kann und häufig tödlich verläuft. Im Rahmen einer internationalen Phase-2-Studie unter Leitung von Dr. Othman Al-Sawaf und Professorin Dr. Barbara Eichhorst (Deutsche CLL Studiengruppe) konnte erstmalig die Wirksamkeit einer neuartigen Immuntherapie in Kombination mit einem Enzymblocker erprobt werden.
Die Ergebnisse wurden in Nature Medicine publiziert und haben bereits Eingang in aktuelle Therapieleitlinien in den USA und Deutschland gefunden. Das Forschungsteam konnte zeigen, dass eine kombinierte Immuntherapie mit dem Antikörper Tislelizumab und dem Enzymblocker Zanubrutinib bei über der Hälfte der eingeschlossenen Studienpatientinnen und -patienten zu einem anhaltenden Ansprechen führte. Nach einem Jahr lebten noch über 70 Prozent der Patienten und 46 Prozent befanden sich in Remission.
Professor Dr. Eliav Lieblich

Professor Dr. Eliav Lieblich LL.M, der erste Hans Kelsen-Gastprofessor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät, erhält den Max Planck Cambridge Prize for International Law. Er erhält den Wissenschaftspreis von der Max-Planck-Gesellschaft für seine herausragenden, innovativen und originellen Beiträge im Bereich des Internationalen Humanitären Rechts (IHL) und des allgemeinen Völkerrechts. Der Preis wird alle zwei Jahre an einen »mid-career scholar« vergeben, der bedeutende Fortschritte im internationalen Recht erzielt hat. Die Preisverleihung findet am 14. November 2025 am Lauterpacht Centre in Cambridge statt.
Professor Dr. Marc Fischer

Professor Dr. Marc Fischer, Marketing Area, wurde zum Mitherausgeber des Journal of Marketing ernannt. Das fünfköpfige Redaktionsteam unter der Leitung von Professor Jan-Benedict E.M. Steenkamp von der Kenan-Flagler Business School, UNC-Chapel Hill, wird seine dreijährige Amtszeit am 1. Juli 2025 beginnen.
Das Journal of Marketing ist laut seinem zitationsbasierten Impact-Faktor die älteste und einflussreichste Zeitschrift der Spitzenklasse im Bereich Marketing. Es ist die führende Plattform für fundierte Forschung im Marketing und schlägt eine Brücke zwischen Theorie und Anwendung. Fischer ist der erste Herausgeber, der von einer Institution in Europa ernannt wurde.
Prof. Dr. Andreas Horn

Der Neurowissenschaftler Prof. Dr. med. Andreas Horn erhält über eine Laufzeit von acht Jahren die mit drei Millionen Euro dotierte Stiftungsprofessur für Computationale Neurologie der Hermann und Lilly Schilling Stiftung für medizinische Forschung an der Universität zu Köln. Die Computationale Neurologie macht sich computergestützte Verfahren zur Erweiterung des Verständnisses neurologischer Systemfunktionen zu Nutze. Die Schilling-Professur ist in ein exzellentes Forschungsumfeld eingebettet und bündelt ein breites Spektrum an Expertise. Mit der Professur ist die Gründung eines neuen Instituts für Netzwerkstimulation unter Leitung von Prof. Dr. med. Andreas Horn verbunden. Die Schilling-Stiftung fördert seit 50 Jahren herausragende kliniknahe Grundlagenforschung.
Professor Dr. Matthias Fischer
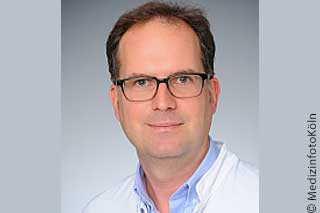
Univ.-Prof. Dr. Matthias Fischer, Leiter der Experimentellen Pädiatrischen Onkologie an der Uniklinik Köln, wird für seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen zur Erforschung des Neuroblastoms mit dem Deutschen Krebspreis 2025 in der Kategorie „Experimentelle Forschung“ ausgezeichnet. Der Preis, verliehen von der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebsstiftung, zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Onkologie. Als führender Physician Scientist – forschender Arzt – hat Prof. Fischer entscheidende Erkenntnisse zur molekularen Klassifikation des Neuroblastoms, eines hochkomplexen Tumors des Kindesalters, geliefert und damit neue Wege für Diagnose und Therapie für betroffene Kinder eröffnet.
Professorin Dr. Nadine Oberste-Hetbleck

Professorin Dr. Nadine Oberste-Hetbleck, Direktorin des Zentralarchivs für deutsche und internationale Kunstmarktforschung (ZADIK), wurde am 1. Januar 2025 von den Mitgliedern der Klasse der Künste als neue Sekretarin gewählt. Sie folgt damit auf den renommierten Bildhauer und langjährigen Sekretar der Klasse Professor Dres. h.c. mult. Anthony Douglas Cragg. Mit Professorin Dr. Nadine Oberste-Hetbleck steht erstmals eine Frau an der Spitze dieses besonderen Zusammenschlusses aus Forschenden und Kunstschaffenden in der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste.
Die Kunstwissenschaftlerin leitet seit 2020 das ZADIK. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit dem Kunstmarkt in seinen unterschiedlichen Ausprägungen und Themen. Ihr wissenschaftliches Interesse erstreckt sich dabei nicht nur auf Marketingstrategien in Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch auf die Institutionen, Zusammenschlüsse und Akteure des privaten Kunstmarkts, des staatlichen Kulturbetriebs und der Zivilgesellschaft.
Oberste-Hetbleck ist seit 2021 Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Unterstützt wird sie in ihrer neuen Funktion als Sekretarin von dem Bildhauer Andreas Schmitten, der zum stellvertretenden Sekretar der Klasse der Künste gewählt wurde. Nadine Oberste-Hetbleck möchte gemeinsam mit Andreas Schmitten an die Aktivitäten von Tony Cragg und Mischa Kuball anknüpfen, die Akademie zu einem lebendigen Ort des Diskurses mit der Öffentlichkeit zu machen. Sie sieht in der verstärkten Vermittlung künstlerischer Positionen in unsere Gesellschaft eine große Chance, neue Perspektiven zu komplexen Themen aufzuzeigen und zu wertvollen Reflektionsprozessen anzuregen.
Seit 1970 bringt die Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste die führenden Forschenden des Landes zusammen. Im Jahr 2008 öffnete sich die Gelehrten-Gemeinschaft zudem den Künsten. Die Nordrhein-Westfälische Akademie ist damit die erste und bisher einzige Wissenschaftsakademie, die die Künste als eigenständige Klasse integriert hat.
Professor Dr. Bernd Böttiger

Univ.-Prof. Dr. med. Bernd Böttiger, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rates für Wiederbelebung (GRC) und Bundesarzt des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wurde mit der Ehrendoktorwürde der Universität Thessaloniki ausgezeichnet.
Kölner Arzt und Sammler Reiner Speck erhält Ehrendoktorwürde
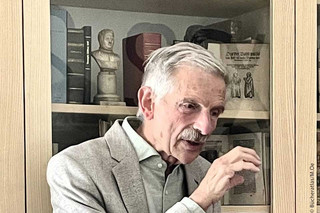
Der Kölner Arzt, Literatur- und Kunstsammler Dr. med. Reiner Speck erhält am 15. Januar 2025 die Ehrendoktorwürde der Philosophischen Fakultät der Universität zu Köln. Die Fakultät verleiht ihm die Ehrendoktorwürde in Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die Wissenschaft, insbesondere um die Romanische Philologie. Gewürdigt werden die wissenschaftliche Relevanz seiner mit großem philologischem und ästhetischem Gespür erstellten Sammlung von Literatur und Kunst sowie sein engagiertes Wirken als Initiator von Forschungs- und Transferaktivitäten zur Vermittlung französischer und italienischer Literatur.
Der Urologe Reiner Speck, Jahrgang 1941, hat über Jahrzehnte eine Sammlung von Werken des französischen Schriftstellers Marcel Proust aufgebaut. Seine Proust-Sammlung zählt weltweit zu den beiden größten Privatsammlungen dieser Art. Sie umfasst mehrere Manuskripte, weit über hundert Briefe und zahlreiche Zeichnungen des Autors sowie andere Materialien, etwa Rezeptionsdokumente und Photographien. Werke aus seiner Sammlung wurden mehrfach für Ausstellungen im In- und Ausland ausgewählt. Auch durch eigene fachkundige Studien hat Speck die Werke für die Literaturwissenschaft erschlossen. Zudem hat er als Mitbegründer und Präsident der deutschen Proust-Gesellschaft der Forschung zu diesem Autor wichtige Impulse gegeben. Von der Proust-Gesellschaft wurden in Deutschland, Österreich und der Schweiz in Kooperation mit den Universitäten vor Ort bisher zwanzig wissenschaftliche Tagungen organisiert.
Die Proust-Sammlung ist seit 2012 in Köln-Müngersdorf in einem Bau von Oswald Mathias Ungers untergebracht. Das von der Dr. Speck-Literaturstiftung getragene private Literaturhaus beherbergt nicht nur die Bibliotheca Proustiana, sondern auch eine bedeutende Sammlung mit Werken von Francesco Petrarca. Die Bibliotheca Petrarchesca umfasst Bildnisse und zahlreiche seltene Ausgaben des italienischen Dichters, darunter auch einige Handschriften. Specks Petrarca-Sammlung wurde schon mehrfach von renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der deutschen Renaissanceforschung aufgesucht.
Darüber hinaus hat sich Reiner Speck als feinsinniger Sammler zeitgenössischer Malerei und Grafik einen Namen gemacht. Zwar hat er einen Teil seiner Kunstsammlung 2008 an eine Privatsammlung verkauft, um mit dem Erlös seine Proust- und Petrarca-Bibliothek zu finanzieren. Zentrale Werke und Werkgruppen, insbesondere solche mit literarischen Bezügen (Polke, Twombly), sind jedoch weiterhin in seinem Besitz und werden von ihm für Ausstellungsprojekte weltweit zur Verfügung gestellt. Speck spielt auch heute noch eine aktive Rolle in der rheinischen Kunstszene.
Professor Dr. Reinhard Strey

Professor Dr. Reinhard Strey, Institut für Physikalische Chemie und Kolloidchemie, ist die Overbeek-Goldmedaille für sein Lebenswerk verliehen worden.
Professor Strey hielt von 1996 bis zu seinem Ruhestand 2015 den Lehrstuhl für Physikalische Chemie an der Universität zu Köln inne. Seine Forschungsinteressen lagen und liegen im Bereich der Grenzflächenphänomene, Struktur und Phasenverhalten komplexer Fluide und Nukleation. Besonders im Bereich der Mikroemulsionen hat er mit fortschrittlichen Methoden wie der Kleinwinkelstreuung und Cryo-Elektronenmikroskopie wichtige Beiträge zum Verständnis dieser Systeme geleistet und existierende Theorien weiterentwickelt.
Die Overbeek-Goldmedaille (Overbeek Gold Medal) ist eine seit 2005 jährlich vergebene Auszeichnung im Bereich der Wissenschaft der Kolloide und Grenzflächen, die von der European Colloid & Interface Society (ECIS) für das Lebenswerk eines Forschers vergeben wird. Sie ist zu Ehren des niederländischen Kolloidwissenschaftlers Theodor Overbeek (1911–2007) benannt. Overbeek war auch der erste Empfänger des Preises.
Professor Dr. Ludwig Kuntz, Dr. Kerstin Wellermann, Professor Dr. Bernhard Roth
Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung des 23. Deutschen Kongresses für Versorgungsforschung am 25. September 2024 hat die Jury des Deutschen Netzwerks Versorgungsforschung (DNVF) den Wilfried-Lorenz-Versorgungsforschungspreis 2024 vergeben. Preisträger*innen der Universität zu Köln waren Professor Dr. Ludwig Kuntz, Dr. Kerstin Wellermann und Professor Dr. Bernhard Roth.
Sie haben zusammen mit ihren Kollegen Professor Dr. Felix Miedaner (Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften) und Professor Dr. Stefan Scholtes (University of Cambridge) die ausgezeichnete Studie »Service Quality Implications of Long Periods of Consecutive Working Days: An Empirical Study of Neonatal Intensive Care Nursing Teams« erstellt.
Die Studie untersucht die Auswirkungen unmittelbar aufeinander folgender Arbeitstage auf die Versorgungsqualität in der neonatologischen Intensivpflege. Ausgangspunkt dieser Analyse ist die gängige Praxis, dass Krankenhäuser ihre Personalrichtlinien häufig auf sichere tägliche Kennzahlen wie das Verhältnis von Pflegekraft zu Patient stützen. Es besteht weitgehend wissenschaftlicher Konsens, dass eine damit einhergehende angemessene Personalausstattung in der Pflege positive Effekte auf die Versorgungsqualität hat. In der Praxis sehen sich Krankenhäuser jedoch mit der Herausforderung konfrontiert, auf unvorhergesehene Nachfrageanstiege oder Personalengpässe reagieren zu müssen. In solchen Situationen wird häufig auf Pflegekräfte zurückgegriffen, die zusätzliche aufeinanderfolgende Arbeitstage übernehmen, um Personalengpässe zu überbrücken.
Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass diese Vorgehensweise, obwohl sie kurzfristig Personalprobleme löst, unbeabsichtigt die Versorgungsqualität und -sicherheit negativ beeinträchtigen kann und somit die Vorteile einer höheren Personalausstattung untergraben könnte. Demgegenüber kann eine Begrenzung der Anzahl aufeinanderfolgender Arbeitstage signifikante Verbesserungen in der Intensivpflege bewirken. Für die Versorgungsqualität sollte daher nicht nur die tägliche Personalausstattung, sondern auch die Länge der Arbeitszeiträume von Pflegekräften berücksichtigt werden.
Generalkonsul David Gill

Generalkonsul David Gill wurde auf Anregung des Rektors Professor Dr. Joybrato Mukherjee von KölnAlumni, dem Netzwerk der Universität zu Köln, mit der Honour-Alumnus-Urkunde ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt den bisherigen Generalkonsul am Deutschen Generalkonsulat in New York für seine langjährige Unterstützung der Universität zu Köln und der Arbeit ihres Verbindungsbüros in New York. Leiterin Dr. Eva Bosbach überreichte ihm die Urkunde am 20. August bei seiner feierlichen Verabschiedung im German House Auditorium in New York. Gill ist designierter Deutscher Botschafter in Irland.
Dr. Martin Dichter

Eine Studie am Institut für Pflegewissenschaft der Universität zu Köln unter Beteiligung von Erstautor Dr. Martin Dichter hat den Theo und Friedl Schöller-Preis 2024 erhalten. Im Rahmen des Kölner Projekts konnten vorhandene Schlafprobleme von Menschen mit Demenz in Pflegeheimen reduziert werden. Der Theo und Friedl Schöller-Preis wird seit 2013 jährlich vom Klinikum Nürnberg ausgeschrieben, um gemeinsam mit der Theo und Friedl Schöller-Stiftung Forschungsarbeiten auszuzeichnen, die eine gute Versorgung älterer Menschen konstruktiv untersuchen. Mit dem Preisgeld von 20.000 Euro ist die Auszeichnung die am höchsten dotierte auf dem Gebiet der Altersmedizin in Deutschland. In diesem Jahr wurde neben dem Kölner Projekt ein weiteres Projekt des Universitätsklinikums Marien Hospital Herne ausgezeichnet.
Menschen mit Demenz leiden häufig an Schlafproblemen, jeder fünfte Mensch mit Demenz in einer stationären Langzeitpflegeeinrichtung ist betroffen. Weitere Gesundheitsprobleme sind oft die Folge. Aktuelle Übersichtsarbeiten zeigen, dass es derzeit keine wirksamen Medikamente zur Verringerung von Schlafproblemen bei Menschen mit Demenz gibt. Die Studie unter Leitung des Kölner Instituts für Pflegewissenschaft zielte darauf ab, eine neu entwickelte, komplexe nicht-pharmakologische Intervention zur Schlafförderung zur Vermeidung beziehungsweise Reduktion von Schlafproblemen von Menschen mit Demenz in der stationären Langzeitpflege hinsichtlich ihrer Effekte zu untersuchen.
Im Verlauf einer Demenz sind Ein- und Durchschlafprobleme und nächtliche Unruhe ein häufiges Symptom. Das Zeitgefühl der Betroffenen kann gestört sein, sodass sich ihr Tag-Nacht-Rhythmus verschiebt. Aber auch Medikamente, Ängste, der typische Bewegungsdrang oder schlafhemmende Routinen in den Einrichtungen können bewirken, dass die Menschen schlecht schlafen. Schlafförderung hat für die Pflege und Versorgung von Menschen mit Demenz somit einen hohen Stellenwert. Die Wirksamkeit des entwickelten Konzepts wurde in einer randomisierten kontrollierten Untersuchung belegt.
Professorin Dr. Elke Kalbe, Dr. Kristin Folkerts, Moritz Ernst, Professorin Dr. Nicole Skoetz

Die Hilde-Ulrichs-Stiftung hat ihren diesjährigen Stiftungspreisen an ein Forschungsteam der Uniklinik Köln und der Medizinischen Fakultät verliehen. Ausgezeichnet wurden Projektleiterin Professorin Dr. Elke Kalbe, Dr. Kristin Folkerts, Gerontologin und Stellvertretende Leitung Medizinische Psychologie, Moritz Ernst, Erstautor der Arbeit und stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe für evidenzbasierte Medizin, sowie Professorin Dr. Nicole Skoetz, Leiterin des Instituts für Gesundheitswesen, für die Untersuchung »Physische Interventionen bei Menschen mit Morbus Parkinson: Ein systematisches Review mit Netzwerk-Metaanalyse (PIPa-Net)«.
Die Meta-Studie untersucht die Wirksamkeit von unterschiedlichen Bewegungsangeboten auf die Schwere der Bewegungssymptome, die Lebensqualität und Nebenwirkungen bei Menschen mit Parkinson. Das Fazit: Hauptsache Bewegung! Die im Review ausgewertete Evidenz aus 156 randomisierten Studien spricht für günstige Auswirkungen von Sport für Parkinson-Erkrankte. Die genaue Art der Bewegung ist, so die Forschenden, zweitrangig. Parkinson kann nicht geheilt, aber die Symptome können gelindert werden, wobei auch Physiotherapie oder andere Bewegungsangebote helfen können. Sport – so weiß man – hat vielfältige positive Effekte auf die Gehirngesundheit und auch auf Symptome der Parkinson-Krankheit. Bislang war jedoch unklar, ob bestimmte Arten von Bewegung bei dieser Zielgruppe besser wirken als andere. Die Kölner Forscher*innen konnten nun herausfinden, dass die Art der Bewegung – ob Nordic Walking, Tanzen, Tai Chi oder Aquagymnastik – weniger wichtig ist. Menschen mit Parkinson sollten daher ermuntert werden, ihren persönlichen Vorlieben an Bewegungsangeboten zu folgen.
Der Morbus Parkinson ist eine fortschreitende Erkrankung des Gehirns, von der meist Menschen über 60 betroffen sind. Die Symptome beginnen nach und nach und umfassen vor allem Probleme mit der Bewegung wie zum Beispiel Bewegungsverlangsamung, Zittern, Muskelsteifheit und Probleme mit dem Gleichgewicht und der Koordination. Die Betroffenen können auch Depressionen, Stimmungsschwankungen, erhöhte Müdigkeit, Schlafstörungen und kognitive Beeinträchtigungen, wie beispielsweise Schwierigkeiten beim Denken oder mit dem Gedächtnis, haben.
Dr. Sebastian Walter

Dr. Sebastian Walter, Oberarzt in der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und plastisch-ästhetische Chirurgie der Uniklinik Köln und der Medizinischen Fakultät, ist auf dem diesjährigen Deutschen Kongress für Orthopädie und Unfallchirurgie (DKOU) in Berlin zusammen mit Dr. Robert Nißler von der ETH Zürich mit dem Heinz-Mittelmeier-Preis ausgezeichnet worden. Sie erhielten den mit insgesamt 5.000 Euro dotierten Preis für ihre Arbeit mit dem Titel »Material-Intrinsic NIR-Fluorescence Enables Image-Guided Surgery for Ceramic Fracture Removal«, die im Advanced Healthcare Materials Journal publiziert wurde.
Die Forscher entwickelten darin eine Methode, um Keramikpartikel – wie sie beispielsweise bei Implantatbruch künstlicher Hüftgelenke auftreten – im Weichgewebe mittels NIR-Fluoreszenz zu detektieren. Dies könnte in Zukunft die vollständige Entfernung der Partikel aus dem Gewebe und damit die anschließende Neuimplantation einer Keramikgleitpaarung ermöglichen.
Patrik Schelemei

Patrik Schelemei, Medizinischer Doktorand in der Arbeitsgruppe von Professor Dr. Holger Winkels, Experimentelle Kardiologie im Herzzentrum der Uniklinik, ist Ende September auf den Herztagen der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie mit dem Wissenschaftspreis der Segnitz-Ackermann-Stiftung ausgezeichnet worden. Er erhält den mit 3.000 Euro dotierten Preis für seine Arbeit mit dem Titel »Olfactory receptor 2 drives abdominal aortic aneurysm by promoting CX3CR1-mediated monocyte recruitment«.
Makrophagen, die als sogenannte Fresszellen im angeborenen Immunsystem für die Abwehr von Krankheitserregern zuständig sind, sind kritisch an der Entstehung eines Bauchaortenaneurysmas – einer fatalen Ausbeulung der Hauptschlagader mit hoher Sterblichkeit – beteiligt. In der ausgezeichneten Arbeit konnten die Forschenden zeigen, dass diese Makrophagen in der Hauptschlagader von Menschen und Mäusen mit Bauchaortenaneurysma einen Geruchsrezeptor, den olfaktorischen Rezeptor 2 (Olfr2), ausbilden. Mechanistisch ist der Olfr2 auf Makrophagen maßgeblich an der Entzündungsreaktion in der Gefäßwand beteiligt und treibt die Einwanderung von Monozyten, den Vorläuferzellen der Gefäßmakrophagen, aus dem Blut in das Bauchaortenaneurysma voran. Sowohl die genetische Defizienz als auch pharmakologische Hemmung des Olfr2 konnten vor der Ausbildung eines Bauchaortenaneurysmas schützen.
Alicia Meyer-Hofmann
Alicia Meyer-Hofmann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Zahnerhaltung und Parodontologie im Zentrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Uniklinik, ist von der Deutsche Gesellschaft für Parodontologie e.V. auf deren Jahrestagung in Bonn Ende September mit dem 1. Bestpreis im DG PARO-Kurzvortragswettbewerb 2024 geehrt worden. Sie erhält den mit 750 Euro dotierten Preis für ihren Vortrag zur Arbeit mit dem Titel »Mundgesundheitskompetenz in verschiedenen Altersgruppen«. Die vorgestellten Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse zur Mundgesundheitskompetenz von Patientinnen und Patienten, die in der Uniklinik im klinischen Studierendenkurs behandelt wurden. Damit können gezielte Präventionskonzepte, die anhand der individuellen Bedürfnisse und des klinischen Risikoprofils des Einzelnen entwickelt werden, um eine mundgesunde Situation herzustellen, wovon langfristig auch die Allgemeingesundheit profitiert.
Annika Meyer

Annika Meyer, Assistenzärztin in der Klinik für Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin, wurde von der Deutschen Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin (DGKL) mit dem Förderpreis »Digitales Labor« ausgezeichnet. Sie hat den Preis für ihre Arbeiten zu Künstlicher Intelligenz am Institut für Klinische Chemie der Uniklinik Köln und der Medizinischen Fakultät erhalten.
Die Ärztin ging der Frage nach, wie gut ChatGPT im medizinischen Bereich funktioniert. Dazu ging Meyer einen innovativen Schritt: Sie ließ die KI gleich drei medizinische Staatsexamina lösen. Erstaunliches Fazit: Die aktuellste von Meyer getestete KI-Version bestand die Examina mühelos. Allerdings resultieren gerade daraus auch ernsthafte Risiken. Denn ChatGPT vermochte zwar die medizinischen Fragen des Staatsexamens korrekt zu beantworten – nicht aber jene Fragen, die Patientinnen und Patienten im realen Alltag stellen. Weil die KI aber in der Tonalität eine extreme Professionalität vortäuscht, klingen falsche Antworten gerade für Laien kompetent und richtig. Die Folge: Mitunter Gesunde lassen sich verstärkt ärztlich untersuchen, was wiederum im schlimmsten Fall das Gesundheitswesen unnötig belasten kann. Annika Meyer zufolge bietet ChatGPT ein enormes Potenzial – aber auch viel Luft nach oben im Bereich der medizinischen Alltagsanwendungen.
Die Deutsche Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin (DGKL) hat in diesem Jahr den Förderpreis »Digitales Labor« zum ersten Mal verliehen. Der Grund: Digitalisierung spielt auch im Labor eine immer größere Rolle. Die DGKL unterstützt diese Entwicklung und würdigt herausragende wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der Digitalisierung und KI-Anwendungen in der Laboratoriumsmedizin. Die Auszeichnung wurde auf dem DKLM 2024 in Bremen verliehen und ist mit insgesamt 15.000 Euro dotiert. Den Preis teilen sich dieses Jahr zwei Arbeitsgruppen.
Privatdozentin Dr. Angela Kribs

Privatdozentin Dr. Angela Kribs, Leitende Oberärztin für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin in der Uniklinik Köln, ist mit dem renommierten neonatologischen Preis der Europäischen Gesellschaft für Neonatologie ausgezeichnet worden. Die Verleihung fand im September 2024 in Wien statt.
Dr. Kribs, die sich seit Jahrzehnten für die Versorgung frühgeborener Kinder einsetzt, wurde insbesondere für ihren innovativen Ansatz gewürdigt, der auf den Fähigkeiten des einzelnen Frühgeborenen basiert und die Intensivmedizin nur dort einsetzt, wo sie zwingend notwendig ist. Diese schonende, auf das Wohl und die Entwicklung der Kleinsten fokussierte Versorgung spiegelt sich auch im geplanten Centrum für Familiengesundheit (CEFAM) an der Uniklinik wider, das eine umfassende Begleitung von Familien in besonderen Lebenslagen ermöglichen soll. Ziel ist es, den Frühgeborenen die bestmögliche Unterstützung zu bieten und gleichzeitig ihre Eigenentwicklung zu fördern. Die Verleihung des Preises ist eine Bestätigung für die bedeutenden Fortschritte in der Frühgeborenenversorgung, die in Köln erzielt wurden.
Professor Dr. Julian Koenig

Professor Dr. Julian Koenig von der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik und der Medizinischen Fakultät der Universität hat den diesjährigen Excellence Award der European Society for the Study of Personality Disorders erhalten. Die ausgezeichnete Arbeit mit dem Titel »Age dependent effects of early intervention in borderline personality disorder in adolescents« ist in der Fachzeitschrift Psychological Medicine erschienen.
Die Arbeit adressiert Effekte der frühen Intervention in einer großen Stichprobe von über sechshundert Jugendlichen mit Symptomen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und deren Entwicklung über einen Zeitraum von zwei Jahren. Erstmals konnte die normative Entwicklung der Störung moduliert und gezeigt werden, dass frühe Interventionen einer normativen Verschlechterung der Symptomatik mit höherem Alter vorbeugen können.
Der Preis zeichnet Forschungsteams für publizierte Fachartikel aus, die die Forschung zu Persönlichkeitsstörungen weltweit deutlich voranbringen und einen herausragenden Beitrag zum Verständnis und zur Behandlung von Personen mit Persönlichkeitsstörungen leisten. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.
Privatdozentin Dr. Silke van Koningsbruggen-Rietschel

Privatdozentin Dr. Silke van Koningsbruggen-Rietschel, Leiterin des Mukoviszidosezentrums Köln und des Mukoviszidose-Studienzentrums der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin der Uniklinik Köln, wurde für die kommenden drei Jahre zur Vizepräsidentin der Europäischen Mukoviszidosefachgesellschaft (European Cystic Fibrosis Society – ECFS) ernannt.
Die ECFS ist eine internationale Fachgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebenserwartung und Lebensqualität von Menschen mit Mukoviszidose durch qualitativ hochwertige Forschung und Etablierung von Behandlungsstandards zu verbessern. Sie unterstützt dabei ein Netzwerk internationaler CF-Spezialisten in Klinik und Forschung, welches zusammen mit europäischen Patientenorganisationen, Zulassungsbehörden und anderen Fachgesellschaften den Informationsaustausch fördert. Bevor Privatdozentin Dr. van Koningsbruggen-Rietschel zur Vizepräsidentin der ECFS ernannt wurde, leitete sie das Studiennetzwerk ECFS-CTN, das die klinischen Studien zur Mukoviszidose in Deutschland koordiniert.
Lena Haarmann, M. Sc.

Lena Haarmann, M. Sc., Psychologin in der Abteilung für Medizinische Psychologie, Neuropsychologie & Gender Studies an der Uniklinik Köln, wurde beim 1. Bochumer Symposium für Diversitätsmedizin mit dem Posterpreis ausgezeichnet. Sie präsentierte ihr Poster mit dem Titel »Higher Risk of Physical Health Conditions in Sexual Minority Men«. Das Symposium fand am 9. Oktober 2024 am Institut für Diversitätsmedizin der Ruhr-Universität Bochum statt.
In der Studie von Lena Haarmann, die auf einem umfassenden systematischen Review mit Meta-Analysen basiert, wurde erstmalig in einer Übersichtsarbeit das erhöhte Risiko für verschiedene physische Erkrankungen von schwulen und bisexuellen Männern im Vergleich zu heterosexuellen Männern gezeigt. Besonders auffällig waren erhöhte Prävalenzen bei chronischen Atemwegserkrankungen, insbesondere Asthma, sowie bei Kopfschmerzerkrankungen, chronischen Nierenerkrankungen und Hepatitis B/C.
Vor allem in Bezug auf Asthma und Kopfschmerzerkrankungen könnte dies auf das durch den Minderheitenstress häufig dauerhaft erhöhte Stresslevel zurückzuführen sein, das viele queere Menschen erleben. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, Diversitätsaspekte wie sexuelle Identität in der Gesundheitsforschung stärker zu berücksichtigen, um eine bestmögliche Gesundheitsversorgung für alle Menschen zu gewährleisten.
Professorin Dr. Heidrun Golla

Professorin Dr. Heidrun Golla vom Zentrum für Palliativmedizin der Uniklinik und der Medizinischen Fakultät der Universität hat auf der diesjährigen Tagung der European Association of Neuro-Oncology (EANO) in Glasgow den Preis »Best oral presentation for Supportive care & quality of life research« erhalten.
Ausgezeichnet wurde ihr Vortrag mit dem Titel »Effect of early integration of palliative care on the quality of life in glioblastoma patients«. Bei der präsentierten Arbeit handelt es sich um eine multizentrische, randomisierte, klinische Phase-3-Studie, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wurde. Untersucht wurde die Wirkung spezialisierter Palliativmedizin auf Menschen, die an einem Glioblastom erkrankt sind, und deren Angehörigen. An der Studie waren circa hundert Mitarbeitende der Unikliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Freiburg, Köln und München sowie weiterer medizinischer Forschungsinstitute beteiligt. Die Ergebnisse der Studie sollen zeitnah veröffentlicht werden.
Dr. Antonia Howaldt

Dr. Antonia Howaldt hat auf der diesjährigen Tagung der DOG den Wissenschaftspreis der Stiftung Auge für ihre Arbeit zur kornealen Myofibromatose gewonnen. Ihre Arbeit zur »Infantiler Myofibromatose der Hornhaut, verursacht durch neuartige aktivierende Imatinib-empfindliche Varianten in PDGFRB« überzeugte die Jury hochrangiger Expertinnen und Experten aus ganz Deutschland.
Dr. Wei Zhang

Dr. Wei Zhang wurde für seine exzellente Dissertation mit dem DOG-Promotionspreis für grundlagenwissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet. Dieser vom Herrmann-Wacker-Fonds gesponserte Preis würdigt herausragende Promotionen im Bereich der Augenheilkunde und fördert zukünftige wissenschaftliche Arbeiten. Dr. Zhangs Arbeit ist ein beeindruckender Beitrag zur Grundlagenforschung in der Ophthalmologie.
Dr. Hanhan Liu
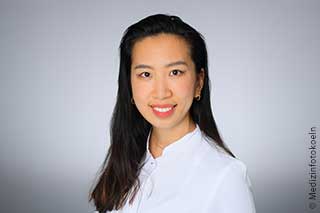
Dr. Hanhan Liu, Clinician Scientist in der Augenheilkunde, ist mit dem DOG-Helmholtz-Forschungspreis ausgezeichnet worden. Dieser Preis würdigt junge Ophthalmologinnen und Ophthalmologen unter 40 Jahren für herausragende wissenschaftliche Leistungen, insbesondere im Bereich der translationalen Forschung und klinischen Studien. Dr. Liu erhielt die Auszeichnung für ihre innovative Forschung über die Rolle von Wasserstoffsulfid und Ferroptose beim Glaukom.