1. Allgemeine Psychologie I u. II
ÜV |
Sprache - Denken - Sprechen: am Beispiel des Genderproblems |
Mo 14.15 - 15.45 HL / R 349 |
Allgemeine Psychologie I, Sozialpsychologie |
2std. (4. Sem.) | |
B. Scheele |
Beginn: 20.04.98
Inhalt: Das "linguistische Relativitätsprinzip" (W. v. Humboldt, Sapir/Whorf) behauptet den 'mächtigen' Einfluß von Sprache (als soziales System) auf unser alltägliches Denken, Handeln, Tun und Lassen - und damit auch auf das, was (inbesondere von der feministischen Linguistik) mit 'männlichem vs. weiblichem Sprechen' beschrieben wird? Im Vorlesungsteil möchte ich zunächst einführen in die von psychologischer Seite erfolgte theoretisch-empirische Ausarbeitung der 'Sprachdeterminismus-These' im Anschluß an Sapir/Whorf; im Seminarteil soll dann daran inhaltlich anschließend das Phänomen des (verbalen) genderspezifischen Kommunizierens (in eher privaten sowie öffentlichen Lebensbereichen) 'erklärend' aufgearbeitet und diskutiert werden.
Basisliteratur: Prüfungsliteratur zu 'Denken' und 'Sprache' im Fach Allgemeine Psychologie I sowie zu 'Sprache und Wissen' im Fach Sozialpsychologie (für weitere Literatur s. den Handapparat 'Sprache - Denken - Sprechen').
Leistungsnachweis: Hausarbeit auf der Grundlage eines vorgetragenen Referats.
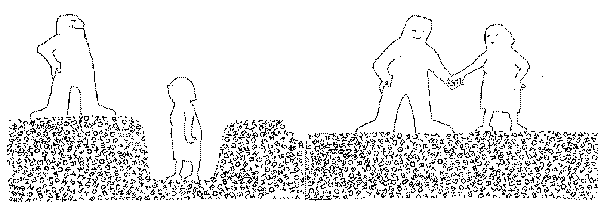
S |
Gedächtnis und Problemlösen |
Mi 09.15 - 10.45 |
Allgemeine Psychologie I |
HL / HS 254 | |
W. Hussy |
2std. (2./4. Sem.) |
Beginn: 15.04.98
Inhalt: Seminar zur Vorlesung aus dem WS 1997/98. Vertiefung klassischer Fragestellungen und Experimente anhand von Referaten und Demos.
Basisliteratur: Hussy, W. (1993): Denken und Problemlösen. Kohlhammer: Stuttgart.
Leistungsnachweis: Scheinerwerb durch Übernahme eines Referats und regelmäßige Teilnahme.
S |
Aspekte autobiographischen Erinnerns |
Do 11.15 - 12.45 |
Allgemeine Psychologie I |
HL / R 349 | |
B. Keller |
2std. (2.ff. Sem.) |
Beginn: 16.04.98
Inhalt: Ausgehend von kognitionspsychologischen Ansätzen zum Gedächtnis sollen zunächst Modelle, Untersuchungsstrategien und Ergebnisse zum autobiographischen Gedächtnis vorgestellt werden. Daran anschließend werden Entwicklung und Veränderung von Funktionen autobiographischen Erinnerns im Verlauf der Lebensspanne aufgearbeitet. Neben den Einflüssen von Alter und Geschlecht sind dabei kulturelle Aspekte zu berücksichtigen.
Basisliteratur: Brewer, W.F. (1986): What is autobiographical memory? In D.C. Rubin (ed.): Autobiographical memory (25-49). New York: Cambridge University Press. Keller, B. (1996): Rekonstruktion von Vergangenheit. Opladen: Westdeutscher Verlag (daraus insbes. Kap. 1: Autobiographisches Gedächtnis, u. Kap. 2: Die soziale Verfaßtheit von Erinnerungen). Kluwe, R. (1990): Gedächtnis und Wissen. In H. Spada (ed.): Lehrbuch Allgemeine Psychologie (115-187). Bern: Huber.
Leistungsnachweis: Regelmäßige Teilnahme sowie die Übernahme eines Referates oder einer Hausarbeit.
S |
Selbstreflexivität und Subjektive Theorien |
Do 11.15 - 12.45 |
Allgemeine Psychologie I |
HL / R 340 C | |
R. Obliers |
2std. (2. - 4. Sem.) |
Beginn: 16.04.98
Inhalt: Subjektive Theorien zielen auf die komplexen Sinnwelten von Alltagsmenschen, mit denen diese sich selbst und die Welt zu erklären, vorherzusagen und zu verändern versuchen. Derartige Alltagstheorien haben häufig impliziten Charakter und müssen dem Alltagsmenschen nicht ohne weiteres reflexiv verfügbar sein. Ihre Aufdeckung bedarf besonderer methodischer Anstrengungen. Die hierzu entwickelten Verfahren im Rahmen des 'Forschungsprogramms Subjektive Theorien' (FST) tragen dazu bei, diese Nicht-Verfügbarkeit in reflexive Verfügbarkeit zu überführen. Unter methodischer Mitbeteiligung der zu untersuchenden Person beinhalten sie insbesondere die Chance eines Selbsterkenntnisgewinns. Das Seminar gibt eine Einführung in den wissenschaftstheoretischen Hintergrund, in die methodischen Möglichkeiten und präsentiert konkrete Untersuchungsbeispiele.
Basisliteratur: Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J. & Scheele, B. (1988). Forschungsprogramm Subjektive Theorien. Eine Einführung in die Psychologie des reflexiven Subjekts. Tübingen: Francke Verlag. Scheele, B. & Groeben, N. (1988). Dialog-Konsens-Methoden zur Rekonstruktion Subjektiver Theorien. Tübingen: Francke Verlag.
Leistungsnachweis: Regelmäßige Teilnahme sowie Übernahme eines Referates oder einer Hausarbeit
A |
Techniken des empirischen Arbeitens |
Di 16.00 - 17.30 |
K |
Allgemeine Psychologie I u. II |
HL / R 349 |
B. Scheele u. M. Schreier |
2std. (4.ff. Sem.) |
Beginn: 14.04.98
Inhalt: s.u.: Kolloquien
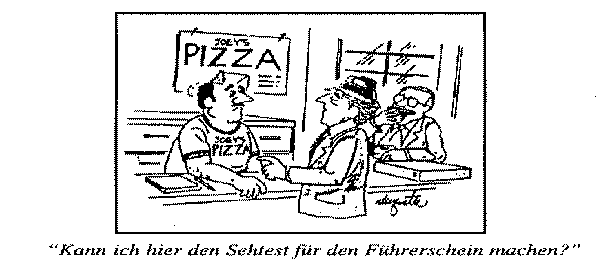
A |
"Wahrnehmungen" (mit Experiment) |
Mo 16.15 - 17.45 |
Allgemeine Psychologie I |
RB / s. A. | |
P. Scheffler |
2std. (2.ff. Sem.) |
Beginn: 14.04.98
Inhalt: Experimente zum Vermeiden von Unfällen.
Erlebte Geschwindigkeiten sind absolute Qualitäten. Physikalische Geschwindigkeiten sind als relativ definiert. Deshalb müssen Autofahrer mit dem Tachometer lernen. An einfachen Fahrsimulatoren lernen wir in dieser Arbeitsgruppe unsere psychischen Eigenarten kennen. Speziell die Unfälle beim zu dichten Hinterherfahren lernen wir einsichtig und geübt zu vermeiden.
Basisliteratur: Scheffler, P. & Brungs, C. (1996): Unmittelbarer psychischer Vergleich von 'Orten' und 'Geschwindigkeiten' mittels Projektoren mit laufenden Lochblenden. (Grundlagenforschung nach Kant). In Schorr, A. (ed.), Experimentelle Psychologie/ 38. TeaP '96. Lengerich: Pabst Science Publishers.
S |
Aggression als motivationspsychologisches Konstrukt |
Di 09.15 - 10.45 |
Allgemeine Psychologie II |
HL / R 349 | |
B. Scheele |
2std. (2./4. Sem.) |
Beginn: 14.04.98
Inhalt: Innerhalb der Motivationspsychologie ist das Konstrukt 'Aggression' von den immer wieder kontrovers diskutierten zentralen Fragen der Psychologie am deutlichsten betroffen. Entsprechend soll die Theorienentwicklung zwischen biologisch vs. lerntheoretisch, persönlichkeits- und situationstheoretisch orientierten Erklärungen nachgezeichnet und auf die aus ihnen jeweils herleitbaren Möglichkeiten im Umgang mit Aggressionsbereitschaft geprüft werden.
Basisliteratur: Heckhausen, H. (1989). Motivation und Handeln (2. Aufl.). Berlin etc.: Springer; daraus Kapitel 10 sowie die u.a. als Prüfungslit. angegebenen Kapitel 1-4, 13 u. 14 (für weitere Literatur s. den Handapparat 'Aggression').
Leistungsnachweis: Hausarbeit auf der Grundlage eines vorgetragenen Referats.
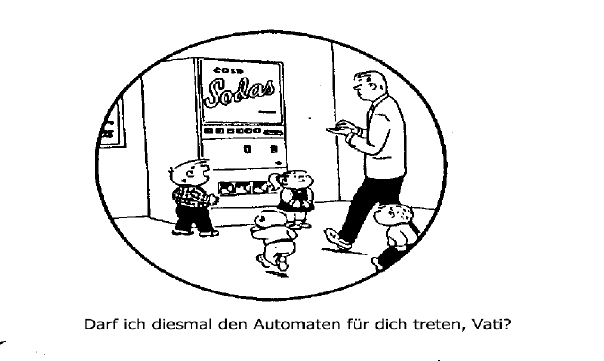
S |
Psychologie der Verantwortungsattribution |
Mi 09.15 - 10.45 |
Allgemeine Psychologie II |
HL / R 349 | |
M. Schreier |
2std. (2./4.Sem.) |
Beginn: 15.04.98
Teilnahmebedingung: Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit an einem Projekt.
Inhalt: Was ist eigentlich 'Verantwortung'? Unter welchen Bedingungen machen wir andere für etwas verantwortlich (z.B. den Computerabsturz heute morgen, die Erdbeben letztes Jahr in Italien, die Studienbedingungen an deutschen Universitäten)? Gibt es einen Unterschied zwischen 'Verantwortung' und 'Schuld'? Mit solchen Fragen befaßt sich die Psychologie der Verantwortungsattribution, die sich in den letzten Jahrzehnten aus der (zunächst auf Kausalzuschreibungen beschränkten) Attributionspsychologie entwickelt hat. Diese Veranstaltung soll in relevante Fragestellungen und theoretische Konzepte der Forschung zur Verantwortungsattribution einführen.
Zur Bearbeitung sollen die Studierenden in Kleingruppen unter Anleitung eine bestimmte Thematik sowohl theoretisch als auch ggf. praktisch-empirisch im Sinne eines Projektes bearbeiten und präsentieren (anstelle von Referaten). Themen für solche Projekte wären beispielsweise: "Für welche gesellschaftlichen Mißstände werden Personen anderer Nationalitäten in der Presse verantwortlich gemacht? Sind diese Zuschreibungen gerechtfertigt?" oder "Welche Entschuldigungen verwenden wir im Alltag? Wann werden diese Entschuldigungen vom Gegenüber nicht mehr akzeptiert?" Etc.
Basisliteratur: Darley, T.M. & Shultz, T.R. (1990). Moral rules: their content and acquisition. Annual Review of Psychology, 41, 525-556; Schreier, M. (1997). Das Erkennen sprachlicher Täuschung. Münster: Aschendorff; daraus: Kap. 1.3.
Leistungsnachweis: Mitarbeit bei der Durchführung und Dokumentation eines Projekts.