Christian Rustige
Telefon: 0221 – 470-3263
Raum: 415
E-Mail: christian.rustige@uni-koeln.de
Forschungsschwerpunkt:
Clusterkomplexe der Seltenerdmetalle mit endohedralen Übergangsmetallatomen
Clusterkomplexe können in einer Vielzahl von metallreichen Halogeniden der Metalle Niob, Tantal, Molybdän, Wolfram und Rhenium beobachtet werden. Die Ausbildung polyedrischer Metallcluster mit Metall-Metallbindungen ist hierbei auf überschüssige d-Elektronen zurückzuführen, die nach Absättigung der Halogenid-Koordinationssphäre verbleiben.
Elektronendefizitäre Clusterkomplexe der d-elektronenarmen
Seltenerdmetalle werden (bis auf wenige Ausnahmen) durch zusätzliche
Elektronen von Heteroatomen stabilisiert, die sich im Zentrum der Seltenerdmetallcluster
befinden. Als innewohnende, sogenannte endohedrale bzw. interstitielle
Atome, kommen neben Atomen von Nichtmetallen wie Kohlenstoff oder Stickstoff,
auch solche der späteren Übergangsmetalle in Betracht.
Durch mannigfaltige Verknüpfungsvarianten über ihre Halogenidkoordinationssphäre
sowie einer möglichen Kondensation der Metallcluster zu größeren
Agglomeraten, Ketten-, Schicht- oder Netzwerkstrukturen, ergibt sich
für diese polaren intermetallischen Verbindungen eine eindrucksvolle
Strukturchemie (s. u.).
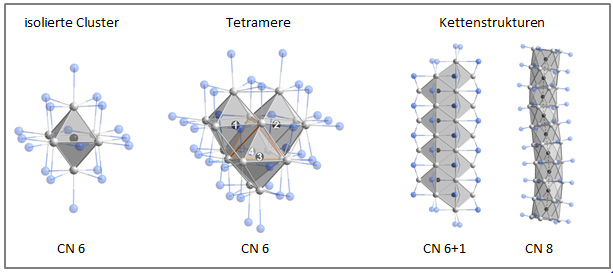
Auswahl verschiedenartiger Clusterkomplexe mit Koordinationszahl (CN)
der endohedralen Atome.
Der strukturelle Aufbau sowie das bisweilen große
magnetische Moment führen z. T. zu bemerkenswerten magnetischen
Phänomenen komplexer Natur, sodass Clusterkomplexe der Seltenerdmetalle
mit endohedralen Übergangsmetallatomen auch in dieser Hinsicht
ein vielversprechendes Teilgebiet der Festkörper-Grundlagenforschung
darstellen.
Zur Synthese werden vor allem klassische Festkörperreaktionen wie
die metallothermische Reduktion (z.T. unter Verwendung eines Flussmittels)
von Seltenerdmetalltrihalogeniden, die ihrerseits mittels einer Precursor-Methode
dargestellt werden, angewandt. Die explorative Synthese neuartiger Clusterkomplexe
stellt dabei aufgrund des unbekannten Phasenschmelzverhaltens sowie
der Oxidations- und Hydrolyseempfindlichkeit der Edukte und Produkte
eine besondere präparative Herausforderung dar. Da sich die thermodynamische
Stabilität vieler derartiger Verbindungen häufig nur über
ein kleines Temperaturintervall zu erstrecken scheint, bedarf es zur
Synthese phasenreiner Präparate einer gezielten Optimierung der
verwendeten Temperaturprogramme.
Diplomarbeit:
„Neue Untersuchungen in den Systemen Tm/X/Z“ (Universität zu Köln, 2008)
Dissertation:
„Interstitiell stabilisierte Clusterkomplexe der Seltenerdmetalle Terbium und Erbium“ (Universität zu Köln, 2011)
Lehre:
-
Betreuung von Grund- und Fortgeschrittenenpraktika der anorganischen Chemie.
-
WS 2011/12: Seminar zum quantitativ analytischen Teil des Praktikums „Anorganische Chemie“ (Teil des Moduls MN-C-AlC).
Sonstiges:
-
Planung, Installation und Wartung von Heiz- und Reglertechnik.

![]()
Prof. Dr. Gerd Meyer - www.gerdmeyer.de
| Universität zu Köln
| zum Seitenanfang
