Norbert Groeben
![]() Zurück zur LEHRE-Seite
Zurück zur LEHRE-Seite
In der vorliegenden Studie werden drei klassische Interpretationsansätze des Kleist'schen Dramas Penthesilea (feministische, existentialistisch-anthropologische und psychoanalytische Interpretation) 38 Leser/innen vorgelegt. Mit einer Komprimierungsvariante der Dialog-Konsens-Hermeneutik wird erhoben, welchen Interpretationsansätzen die jeweilige individuelle Rezeption am nächsten steht. Abschließend werden die festgestellten Interpretationspräferenzen mit der Variable des sozialen Geschlechts in Beziehung gesetzt.
In the present study, three classical interpretations of Kleist's drama Penthesilea (following a feminist, existentialist-anthropological, and psychoanalytic approach respectively) are presented to 38 readers. Employing a compressed version of a dialogue-hermeneutical procedure, the individual readings of the drama are compared to the three interpretations in order to determine which interpretation is of major impact in each of the readings. In a last step, the relation between the preference for the various interpretations and the factor of the readers' gender is further explored.
Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist es, den Einsatz der DialogHermeneutik in literarischen Rezeptionsstudien zu demonstrieren. Das hat zur Folge, daß der Untersuchungsansatz im Vergleich zu üblichen literaturwissenschaftlichen, auch psychoanalytischen, Interpretationen sozusagen eine Ebene höher ansetzt: Es geht darum, welche Interpretationsansätze der Rezeption des literarischen Textes bei konkreten Untersuchungsteilnehmern/innen am ehesten entsprechen. Dazu wird zunächst die Grundstruktur der sog. DialogKonsensVerfahren skizziert; daran schließt sich die Demonstration einer Komprimierungsvariante nach dem Herstellungsprinzip an, mit der die Rezeption des Dramas Penthesilea bei 38 Kölner Studierenden der Psychologie untersucht worden ist. Abschließend werden die wichtigsten Ergebnisse, insbesondere auch in Relation zur GenderOrientierung der Rezipienten/innen, dargestellt und diskutiert.
Die Grundstruktur der DialogKonsensVerfahren ist innerhalb des sog. Forschungsprogramms Subjektive Theorien zur Rekonstruktion hochkomplexer Kognitionsstrukturen (mit zumindest impliziter Argumentationsstruktur, die deshalb Subjektive Theorien genannt werden) entwickelt worden; und zwar federführend von Scheele (Scheele 1988; Scheele & Groeben 1984; 1988; Scheele 1992).
Die Grundstruktur dieser DialogKonsensVerfahren ist die methodische Umsetzung dessen, was vor allem Habermas als die Struktur des psychoanalytischen Verstehens rekonstruiert hat. Nach seiner Rekonstruktion werden im psychoanalytischen Therapieprozeß von seiten der Analytikerin/des Analytikers Interpretationskonzepte entwickelt, die der Patientin/dem Patienten sozusagen >angeboten< werden und denen dann die analysierte Person zustimmt (oder nicht). Die Bedingung der Möglichkeit dafür, daß diese Zustimmung sozusagen den internalen Prozessen und Inhalten der Patienten/innen adäquat ist (und damit der Konsens von seiten der Patienten/innen als >Wahrheit< angesehen werden kann), liegt in der idealen Sprechsituation, die ihrerseits die Bedingung der Möglichkeit für die Wahrhaftigkeit der analysierten Personen darstellt. Diese ideale Sprechsituation wird von den DialogKonsensVerfahren möglichst systematisch methodisch realisiert (wobei es sich selbstverständlich nur um eine approximative Realisierung handeln kann, da schon bei Habermas die ideale als kontrafaktische Sprechsituation expliziert wird). Ein wichtiges Merkmal dieser methodischen Systematisierung besteht darin, daß die Grundstruktur des DialogKonsensVerfahrens zwei Teilschritte vorsieht (vgl. Groeben 1992): zunächst die Inhaltserhebung der (hochkomplexen) Kognitionen bzw. Reflexionen; und im zweiten Schritt dann die Strukturrekonstruktion als theorieanalog in Form der Visualisierung von sog. Subjektiven Theorien (vgl. Abb. 1).
Abb. 1: StrukturLegeVerfahren als methodische Systematisierung einer DialogHermeneutik
Die Inhaltserhebung geschieht in der Regel durch ein strukturiertes Interview, in dem offene, gerichtete und sogenannte StörFragen so aufeinander abgestimmt sind, daß potentielle Artefaktgefahren (wie bloße Handlungsrechtfertigung, vollständigkeitsorientierte Amplifikationen etc.) möglichst kontrolliert werden (vgl. Wahl 1979). Ich gehe in unserem Zusammenhang nicht näher darauf ein, weil dieser Schritt in der hier angewandten Komprimierungsvariante anders realisiert wird.
Der zweite Schritt ist die Strukturrekonstruktion, bei der zunächst die relevanten Konzepte aus dem strukturierten Interview durch das Erkenntnissubjekt extrahiert und auf Kärtchen geschrieben werden, wozu das Erkenntnisobjekt ebenfalls bereits seine Zustimmung geben muß (ggf. werden Formulierungen modifiziert, Konzeptkärtchen ergänzt etc.). Dann gibt es für die Visualisierung des Subjektiven TheorieBildes einen Leitfaden mit Formalrelationen, und zwar spezifisch je nach Fragestellung, Problembereich, Untersuchungsstichprobe etc. Für diese Formalrelationen existiert mittlerweile eine ganze Anzahl unterschiedlicher StrukturLegeLeitfäden (vgl. Dann 1992); der historisch erste Leitfaden stammt aus der sogenannten Heidelberger StrukturLegeTechnik, in der graphische Formalrelationen zur Rekonstruktion Subjektiver Berufstheorien (vor allem von Lehrern/innen) entwickelt und mit Beispielen erläutert worden sind (Scheele & Groeben 1984).
Die historisch letzte Variante, die auch in der vorliegenden Untersuchung zum Einsatz kommen wird, faßt die Fülle der bisher eingesetzten Formalrelationen in alltagssprachlicher Formulierung zusammen, wobei das Prinzip ist, daß man je nach Problembereich und Fragestellung der Untersuchung eine adäquate Teilmenge dieser Relationen (zum einen als Kernrelationen, zum anderen als Ergänzungsrelationen) einsetzt (Scheele, Groeben, Christmann 1992). Einen Ausschnitt solcher Kernrelationen zeigt die Zusammenstellung im Anhang.
Die Untersuchungspartner/innen studieren den jeweils angesetzten StrukturLegeLeitfaden und versuchen, mit Hilfe dieser Formalrelationen und der bereits extrahierten Konzeptkärtchen für ihr Interview ein Strukturbild zu legen. Auch das Erkenntnissubjekt der jeweiligen Untersuchung legt ein solches Strukturbild für das jeweilige Erkenntnisobjekt, und anschließend daran wird im Austausch zwischen Erkenntnissubjekt und Erkenntnisobjekt das KonsensStrukturbild als Integration der beiden vorhergehenden Strukturbilder beschlossen (vgl. Groeben 1992). Entscheidend ist dabei entsprechend dem dialogkonsenstheoretischen Wahrheitskriterium die Zustimmung des Erkenntnisobjekts.
Dieser ganze Vorgang mit den beiden Teilschritten der Inhaltserhebung und Strukturrekonstruktion ist auch von der praktischen Durchführung her so zu gestalten, daß möglichst die ideale Sprechsituation approximiert wird; dafür hat Scheele ein sprechakttheoretisches Rahmenmodell entwickelt, das die kognitiven und motivationalen Voraussetzungen benennt, die es zur Annäherung an die ideale Sprechsituation zu realisieren gilt (Scheele 1988).
Da es sich bei dieser Form der DialogHermeneutik um ein allgemein methodisches Instrument außerhalb von therapeutischen Settings handelt, geht es hier also um die Rekonstruktion von zum Teil aktuell nicht unbedingt vollständig verfügbaren, aber doch zumindest reflexionsfähigen Kognitionen.
Im Rahmen hochschuldidaktischer und kommunikationspsychologischer Untersuchungen ist in den letzten Jahren (von Küppers, Christmann und Groeben) auch eine Komprimierungsvariante der DialogKonsensVerfahren entwickelt worden, die vor allem auf eine differenzierte Inhaltserhebung z.B. mit strukturiertem Interview verzichtet. Statt dessen wird die Evozierung der inhaltlichen Kognitionen der Untersuchungspartner/innen durch die Vorgabe von zwei oder mehr prototypischen Schaubildern versucht; die Untersuchungsteilnehmer/innen haben dabei die Aufgabe, ausgehend von dem ihren Kognitionen am nächsten stehenden Schaubild unter Heranziehung des mit übergebenen StrukturLegeLeitfadens ein eigenes (modifiziertes) Strukturbild herzustellen, das die je individuelle Kognitionsstruktur repräsentiert. Für die vorliegende Untersuchung wurden drei zentrale und möglichst unterschiedliche Interpretationsansätze in ein solches Interpretationsschaubild übertragen: nämlich ein feministischer (I) (nach Hedwig Appelt & Maximilian Nutz (1992) sowie nach Inge Stephan (1984)), ein existentialistischanthropologischer (II) (nach Benno von Wiese (1952) und Walter MüllerSeidel 1981)) und ein psychoanalytischer Interpretationsansatz (III) (nach Lilian Hoverland (1980); Joachim Pfeiffer (1986); Annette Runte (1995)).
Dabei wurden die drei am häufigsten in den literaturwissenschaftlichen Interpretationsbeiträgen zitierten Verse als Belegstellen (mit der Formalrelation >erkennbar an<) mit jeweils einem zentralen Konzept dieser Interpretationsansätze verbunden.
Das psychoanalytische Interpretationsschaubild zeigt Abb. 2., gefolgt von der narrativen Zusammenfassung des Schaubilds.
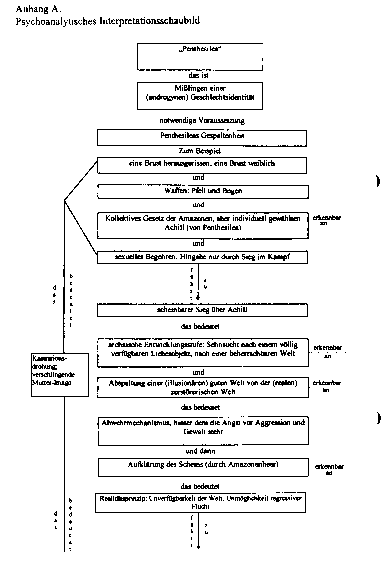

Penthesilea ist ein Drama über das Mißlingen einer (androgynen) Geschlechtsidentität. Notwendige Voraussetzung ist Penthesileas Gespaltenheit, die sich manifestiert in: eine Brust herausgerissen, eine Brust weiblich; Pfeil und Bogen als Waffen; kollektives Gesetz der Amazonen, aber die individuelle Wahl von Achill durch Penthesilea als Liebespartner; und dem sexuellen Begehren, in dem Hingabe nur durch Sieg im Kampf möglich ist. All dies führt zu dem scheinbaren Sieg über Achill, der eine archaische Entwicklungsstufe repräsentiert: die Sehnsucht nach einem völlig verfügbaren Liebesobjekt, nach einer beherrschbaren Welt und die Abspaltung einer (illusionären) guten von der (realen) zerstörerischen Welt. Das bedeutet einen Abwehrmechanismus, hinter dem die Angst vor Aggression und Gewalt steht. Dann erfolgt die Auflösung des Scheins (durch das Amazonenheer), was das Realitätsprinzip repräsentiert: die Unverfügbarkeit der Welt, die Unmöglichkeit regressiver Flucht. Dies führt zum Mißverstehen von Achills scheinbarer Herausforderung durch Penthesilea, woraus die Tötung von Achill durch sie folgt, und zwar in dem Einssein mit dem Liebesobjekt durch orale (kannibalistische) Regression, das heißt, der Wunsch, sich das Liebesobjekt (wörtlich) einzuverleiben (»zum Fressen gern...«). Penthesileas Gespaltenheit zusammen mit dieser oralen Regression enthält sowohl die Kastrationsdrohung als auch das Bild der verschlingenden Mutter. In der bewußten Verarbeitung folgt darauf die Erkenntnis der Unverfügbarkeit von Welt bei Penthesilea, was zur Selbsttötung führt als der einzigen Möglichkeit der Vereinigung von männlichen und weiblichen Identitätsanteilen im Zustand der Nichtexistenz, des Todes. Das bedeutet das Zusammenfallen von Eros (Liebestrieb) und Thanatos (Todestrieb).
Aus Raumgründen sind von den beiden anderen Interpretationsansätzen nicht mehr die Schaubilder, sondern nur noch die narrativen Zusammenfassungen aufgeführt.
Feministischer Interpretationsansatz (I)
Penthesilea ist ein Drama über die Herrschaftsstruktur der Geschlechterbeziehungen und deren (Un)Überwindbarkeit. Als konträre Pole einer solchen Herrschaftsstruktur wird in der matriarchalischen Gesellschaft das Gesetz der Amazonen angesetzt, nämlich Männer zu besiegen und zu benutzen; in der patriarchalischen Gesellschaft die Liebe als Hingabe der Frau. Diese Herrschaftsstruktur (in welcher Variante auch immer) führt zu dem Problem, daß Penthesileas Liebe zu Achill nur in männlicher Form, d.h. als Herrschaft über das Liebesobjekt, möglich ist und eben keiner von beiden die passive, hingebende Rolle übernehmen will. Daraus resultiert, daß Achill die passive, »weibliche« Rolle nur zum Schein übernimmt, was zu einer irrealen Liebesbegegnung als Illusion führt und dann zum Kontrast mit der entgegengesetzten Realität, d.h. in Wirklichkeit hat Achill Penthesilea besiegt; später versucht er, diesen Schein zu wiederholen in seiner Herausforderung, die nur zum Schein erfolgt, die Penthesilea aber als Ernst versteht, so daß sie den Unbewaffneten tötet und ihn sich einverleibt. Dann erkennt sie, daß ihre »Realität« Täuschung war und tötet sich selbst, was bedeutet, daß in der patriarchalischen Gesellschaft die sexuelle Beziehung eine Machtrelation ist, an der die Liebenden zugrunde gehen. Penthesilea verkörpert auf diese Weise Schreck und Wunschbild zugleich: das Selbstbild des ambivalenten, nach Androgynität strebenden, sie aber nicht erreichenden Kleist. Das Schreckbild besteht in der männergleichen, männerverschlingenden Frau, das Wunschbild in der emanzipierten, gleichberechtigten Frau, was bedeutet, daß Androgynität als gegenseitige Befreiung der Geschlechter (durch Auflösung der Geschlechterrollen) in der patriarchalischen Gesellschaft unmöglich bleibt.
Existentialistischanthropologischer Interpretationsansatz (II)
Penthesilea ist ein Drama über das Scheitern gerade des vitalen Lebens an den Grenzen der Wirklichkeit. Notwendige Voraussetzung dafür ist, daß Penthesilea eine nach Unbedingtheit strebende Existenz ist, was sich darin manifestiert, daß sie gegen das Gesetz der Amazonen Achill als individuelles Liebesobjekt wählt und zugleich trotzdem weiterhin dem Gesetz unterliegt, das da heißt: Liebe ist nur durch den Sieg über den Mann möglich. Das führt zum Kampf mit Achill und dem scheinbaren Sieg, der die Einheit ihres Wesens bedeutet: als Königin/Hüterin des Gesetzes und als Liebende. Dann aber erfolgt die Rettung von Penthesilea durch das Amazonenheer, wodurch die Niederlage von Penthesilea deutlich und auch von ihr erkannt wird, was wiederum die Auflösung der Wesenseinheit bedeutet: Als Königin ist sie besiegt, als Liebende erniedrigt. Das heißt, Penthesilea verliert das Volk (durch den Verstoß gegen das Gesetz), verliert Achill (weil diese Liebe nur im Sieg möglich gewesen wäre). Das bedeutet, daß die Weltordnung den Menschen vereinsamt, die Seele zum Mißverstehen bringt, so daß Penthesilea Achills scheinbare Herausforderung mißversteht und ihn (rauschhaft, wahnhaft) tötet. Darauf erfolgt die Erkenntnis des Scheiterns ihrer Liebe, die als einzige verbleibende Handlungsmöglichkeit den Suizid läßt: als einzig mögliche Vereinigung mit dem Geliebten; als SelbstVollendung ihres tragischen Schicksals und als letzte, erhabenste Möglichkeit des Lebens bedeutet dies zugleich, daß in einer lebensverneinenden Wirklichkeit die maximale Vitalität sich letztlich gegen sich selbst kehrt.
Die Untersuchungspartner/innen erhielten außerdem eine Liste von Formalrelationen aus der schon erwähnten alltagssprachlichen Flexibilisierungsvariante; dabei waren nur die Erläuterungen zu den einzelnen Formalrelationen aufgenommen, nicht die Beispiele, weil die Konzepte der Interpretationsschaubilder genügend Beispiele enthielten (vgl. Abb. 3).
Abb. 3: Liste der FormalRelationen
A) In den Interpretationsschaubildern verwendete Relationen (zur Verbindung der Interpretationskonzepte)
1. das ist/das bedeutet
steht für: eine Erklärung, was ein bestimmtes Konzept (ein bestimmter Begriff etc.) bedeutet.
2. und
steht für: die verbindende Aneinanderreihung von Konzepten (Begriffen) und Sätzen.
3. oder
steht für: verschiedene Möglichkeiten, was ein Konzept (Begriff) bedeuten kann. Die Möglichkeiten können sich gegenseitig ausschließen (im Sinne von >entwederoder<), müssen es aber nicht (im Sinne von >oderauch<).
4. Oberbegriff/Unterkategorien
steht für: Unterkategorien zu einem Konzept, das in bezug auf diese Kategorien einen Oberbegriff darstellt.
5. notwendige Voraussetzung
steht für: Voraussetzungen, die bei der Rede von einer bestimmten Handlung notwendigerweise mit unterstellt werden bzw. die eine Person bei dieser Handlung notwendig mit behaupten muß; nicht zu verwechseln mit Bedingungen, von denen das Eintreten einer Handlung, eines Ereignisses etc. in der Regel abhängt (aber nicht notwendigerweise abhängen muß).
6. zum Beispiel/so wie
steht für: Dinge oder Ereignisse, die
als Beispiel für das gemeinte Konzept in der Realität
angesehen werden können; im Unterschied zur >das ist/das
bedeutet<Erklärung also nicht lediglich das, was
mit einem Konzept sprachlich gemeint ist, sondern was an Gegenständen
oder Ereignissen in der Wirklichkeit darunter fällt.
7. erkennbar an
steht für: Zeichen oder Signal, an dem man ein bestimmtes Konzept erkennt, in diesem Fall eine Belegstelle im Text (des Dramas).
8. führt zu
steht für: die Verbindung von Ursachen und Wirkungen. >Führt zu< kann also die Antwort auf zwei Fragerichtungen angeben: einmal auf die Frage >Was führt zu einem vorhandenen Ereignis/einer Handlung?<; zum anderen auf die Frage >Wozu führt ein vorhandenes Ereignis/eine Handlung?< Bei der Antwort auf die >WasFrage< wird die >Ursache< vor das >führt zu<Kärtchen gelegt; bei der Antwort auf die >WozuFrage< wird die >Wirkung< hinter (unter) das >führt zu<Kärtchen gelegt.
9. und zugleich
steht für: Handlungen bzw. Handlungsteilschritte, die gleichzeitig mit anderen Handlungen bzw. Handlungsteilschritten durchgeführt werden. Dazu gehört auch und vor allem die Angabe, auf welche Art und Weise bestimmte Handlungen bzw. teilschritte ausgeführt werden.
10. und dann
steht für: eine Handlung oder einen Handlungsteilschritt, die sich an eine andere schon beschriebene Handlung (bzw. einen schon beschriebenen Handlungsteilschritt) anschließen.
B) Weitere mögliche FormalRelationen
1. indem
steht für: einen Teilschritt innerhalb von Handlungen, wenn die jeweilige (Gesamt)Handlung durch mehrere solche Teilhandlungen zusammengesetzt ist.
2. damit/um zu
steht für: das Ziel, das mit einer Handlung erreicht werden soll. Dabei kommt es nicht darauf an, ob dieses Ziel auch in Wirklichkeit erreicht wird. Zum Beispiel kommt es öfter vor, daß man mit anderen Spaß machen will, die verstehen den Spaß aber ganz anders und werden böse. Durch das Kärtchen >damit/um zu< wird also nur das angestrebte Ziel des Handelns angegeben, unabhängig davon, ob es auch erreicht wird.
3. deshalb
steht für: Begründung einer positiven oder negativen Wertung durch Rückgriff auf die Folgen bzw. Wirkungen des bewerteten Ereignisses, der Handlung etc. Diese Folgen/Wirkungen sind in der Regel auch schon durch das >führt zu<Kärtchen mit dem positiv oder negativ bewerteten Ereignis/der Handlung verbunden. Jetzt wird also noch zusätzlich zu dem >führt zu< festgehalten, daß diese Folgen/Wirkungen die Begründung dafür darstellen, warum dieses Ereignis/Handlung positiv oder negativ bewertet wird.
4. führt allerdings auch zu
steht für: eine Folgewirkung, die durch eine Handlung eigentlich nicht beabsichtigt ist, aber trotzdem (zusätzlich) zur gewünschten Wirkung auch noch auftritt (eine sogenannte Nebenfolge).
5. je mehr, desto mehr/je weniger, desto weniger
steht für: wie A) 8., nur mit gleichläufiger Richtungsangabe.
6. je weniger, desto mehr/je mehr, desto weniger
steht für: wie A) 8., nur mit gegenläufiger Richtungsangabe.
7. entweder ... oder ... oder ...
steht für: verschiedene, sich ausschließende Möglichkeiten von Handlungen oder Handlungsweisen; die Handlungsweisen können sich z.B. auf die Art des Handelns, die Zeit, die verwendeten Mittel etc. beziehen.
8. und sobald
steht für: eine Handlung bzw. einen Handlungsteilschritt, die/der zu einem bestimmten Zeitpunkt einsetzt (oder einsetzen sollte).
9. und bis
steht für: eine Handlung oder einen Handlungsteilschritt, die/der bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgeführt wird (oder ausgeführt werden sollte).
10. und sooft
steht für: Wiederholung einer Handlung oder eines Handlungsteilschrittes, wobei die Anzahl und/oder die Bedingungen von der die Anzahl der Wiederholungen abhängen, angegeben werden.
Die Aufgabe der Versuchsteilnehmer/innen war es dann, ein Schaubild als Ausgangspunkt für die Entwicklung und Ausarbeitung des eigenen Verständnisses des Theaterstücks zu wählen und dieses Schaubild unter Rückgriff auf die Formalrelationen gemäß den eigenen Vorstellungen zu verändern. Dafür wurden in der Instruktion folgende Möglichkeiten angegeben:
Die Aufgabe der Anführung von Belegstellen war gewählt worden, um eine vergleichbare Verarbeitungstiefe bei den Untersuchungspartnern/innen zu gewährleisten, was auch gelungen ist: Die Anzahl der Belegstellen variiert zwischen 3 und 23 mit dem Median von 10,66.
Den Abschluß des Verfahrens bildete eine »Konsenssitzung« mit mir als Untersuchungsleiter, in der die Versuchsteilnehmer/innen mir ihr verändertes Schaubild vorlegten und erläuterten. Eine wichtige Funktion dieser Konsenssitzung war es, zu überprüfen, ob auch alle Konzeptkästchen mit irgendeiner der vorgegebenen Formalrelationen verbunden waren und ggf. unter Rückgriff auf die Entscheidung des Erkenntnisobjekts noch solche Formalrelationen einzufügen, zu vereindeutigen etc. Alle vorliegenden individuellen Interpretationsschaubilder zeigen dabei die Struktur, daß bestimmte Konzeptkästchen aus den vorgegebenen Schaubildern übernommen worden sind, einzelne modifiziert bzw. völlig neu eingefügt wurden einschließlich entsprechender Belegstellen.
Auf diese Weise läßt sich die Frage beantworten, welche der drei literaturwissenschaftlichen Interpretationsansätze mit welcher Häufigkeit in einer jeweiligen Stichprobe von Untersuchungsteilnehmern/innen als der eigenen Rezeption am ehesten vergleichbar akzeptiert werden. Wegen der in dem Drama zentralen GeschlechterProblematik wollte ich die Rezeptionsstudie aber nicht nur auf diese rein deskriptive Fragestellung begrenzen, sondern auch einen potentiellen Zusammenhang mit der Geschlechtersozialisation in den Blick bekommen. Dazu lag es nahe, einen einschlägigen Fragebogen zur geschlechtsspezifischen Sozialisation mit einzusetzen. In diesem Fall wurde der GEPAQ (German Extended Personality Attributes Questionnaire) gewählt, der in der Originalform je sieben Items für die Maskulinitäts und FemininitätsSkala aufweist; aus untersuchungsökonomischen Gründen wurde in dieser Untersuchung aber die komprimierte Version nach Scheele (1990, 149f.) mit insgesamt zehn Items eingesetzt. Der Fragebogen erlaubt es, die Untersuchungspartner/innen vier Kategorien (Maskulinität, Femininität, Androgynität, Indifferenz) zuzuordnen.
Damit sind für die empirische Auswertung der Untersuchung zwei Erkundungsfragen leitend:
1. Welchen literaturwissenschaftlichen Interpretationsansätzen entspricht die Rezeption einer bestimmten Untersuchungsstichprobe in welcher Verteilung?
2. Gibt es Zusammenhänge der so festgestellten Rezeptionsperspektiven mit der (durch den GEPAQ gemessenen) Geschlechterorientierung?
Die Rezeptionsstudie wurde in der skizzierten Struktur im Januar 1997 am Psychologischen Institut der Universität zu Köln mit Hauptfachstudierenden der Psychologie durchgeführt. Es haben 38 Untersuchungspartner/innen teilgenommen; davon fünf männlichen, 33 weiblichen Geschlechts. Obwohl das Fach Psychologie mittlerweile bundesweit einen Frauenanteil von ca. zwei Drittel hat, stellt diese Verteilung auch für das Fach Psychologie in Köln noch einmal eine Überrepräsentation von Frauen dar, die allerdings bei freiwilliger Teilnahme in Untersuchungen zur Rezeption und Verarbeitung literarischer Texte keineswegs ungewöhnlich ist. Der geringe Anteil an männlichen Untersuchungsteilnehmern ist auch der Grund dafür, warum der eigentlich höchst interessante Zusammenhang von biologischem und sozialem Geschlecht anhand dieser Stichprobe nicht berechnet werden konnte.
Bei der Auswertung des GEPAQ werden die oben angesprochenen vier Kategorien so errechnet, daß für die Untersuchungsstichprobe der Median (Mittelwert, unter und über dem jeweils 50 % der Verteilung liegen) auf der Maskulinitäts und Femininitätsskala berechnet werden. Femininität liegt dann vor, wenn ein Individuum auf der Femininitätsskala über dem Median, auf der Maskulinitätsskala unter dem Median liegt; Maskulinität umgekehrt. Bei Androgynität sind beide Werte über dem Median, bei Indifferenz unter dem Median.
Bezüglich der in den je individuellen Interpretationsschaubildern manifesten Rezeptionsperspektive wurde so vorgegangen, daß überprüft wurde, aus welchem Interpretationsansatz die meisten Konzeptkästchen übernommen waren; mit diesem Wert wurde die selbst angegebene Interpretationspräferenz überprüft und ggf. korrigiert. Selbstverständlich wurde auch die Anzahl der Modifikationen, der eigenen neuen Konzepte etc. ausgewertet, über die aber aus Raumgründen hier nicht berichtet werden kann. Die Verteilung der Interpretationspräferenzen bei den 38 Untersuchungsteilnehmern/innen zeigt Tabelle 1.
| Interpr.ansatz | Häufigkeit | Prozent |
|---|---|---|
| I. | 20 | 52,6 |
| II. | 11 | 28,9 |
| III. | 7 | 18,4 |
| Total | 38 | 100,0 |
In der vorhandenen Stichprobe dominiert (mit über
50 %) also ganz eindeutig die feministische Rezeptionsperspektive,
gefolgt von der existentialistischanthropologischen und
am Schluß der psychoanalytischen (mit knapp 1/5 der Versuchsteilnehmer/innen).
Zur Überprüfung eines eventuellen Zusammenhangs mit dem sozialen Geschlecht mußten die vier Kategorien des GEPAQ reduziert werden; dafür wurden die Kategorien feminin und androgyn zusammengelegt, weil in ihnen übereinstimmend der Femininitätsscore über dem Median liegt. Für die resultierenden drei Kategorien maskulin, feminin/androgyn und indifferent ergibt sich die in Tabelle 2 enthaltene Verteilung von Interpretationspräferenzen.
| Interpretationsansatz | ||||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | Total | |
| 1 maskulin |
7 | 3 | 1 | 11 |
| 2 feminin/androgyn |
3 | 0 | 8 | 11 |
| 3 indifferent |
3 | 8 | 1 | 12 |
| Total | 20 | 11 | 7 | 38 |
Chi2 15,79; bei 4 Freiheitsgraden auf dem 0,1%Niveau signifikant.
Es zeigen sich ganz eindeutige Unterschiede dergestalt, daß die existentialistischanthropologische Rezeptionsperspektive vor allem von bezüglich der Geschlechterorientierung indifferenten Versuchspartnern/innen eingenommen wird, während die feministische sowohl von maskulinen als auch femininen/androgynen präferiert wird; allerdings wird der psychoanalytische Interpretationsansatz in halbwegs substantieller Häufigkeit nur von feminin/androgyn Eingestellten präferiert.
Wie erinnerlich war es das Hauptziel dieser Arbeit, die Struktur der dialoghermeneutischen Methodik im Rahmen literarischer Rezeptionsstudien zu demonstrieren. Schon aus Raumgründen war dies nur für die Komprimierungsvariante nach dem Herstellungsprinzip möglich. Gleichwohl zeigt sich nach meiner Einschätzung auch für diese Variante der DialogKonsensVerfahren, daß sie durchaus oder evtl. sogar gerade für die Rezeptionsuntersuchung längerer, komplexer literarischer Texte geeignet ist. Denn die Verdichtung der jeweiligen Rezeptions-perspektiven in ein (wenn auch komplexeres) Schaubild macht doch die unterschiedlichen Interpretationsansätze nicht nur anschaulich deutlich, sondern auch überschaubar und voneinander abgrenzbar. Zugleich stellen die Schaubilder, wie die vorliegende Untersuchung zeigt, ein sehr intensives Anregungspotential für die Rezipienten/innen zur Ausarbeitung der eigenen Rezeptionsperspektive dar. Die meisten von ihnen haben einen von mir so überhaupt nicht erwarteten Umfang an Belegstellennachweisen realisiert und auch bei der Veränderung bzw. Neueinfügung von Konzeptkästchen außerordentliche Sorgfalt walten lassen. Nicht selten waren sie sogar nachdrücklich daran interessiert, die Begründungen für Veränderungen, gestrichene und neueingefügte Konzepte etc. in der abschließenden DialogKonsensSitzung ausführen zu können.
Zugleich ermöglicht der einheitliche Satz von Formalrelationen die überindividuelle (nomothetikorientierte) Zusammenfassung von Interpretationsschaubildern. Die methodischen Voraussetzungen dafür hat Oldenbürger mit seinem »Netzwerkzeug« für die Erstellung von Modalstrukturen geschaffen, dessen Anwendung auf Subjektive Theoriestrukturen von Schreier (1997) ausgearbeitet worden ist. Unter Nutzung dieses Instrumentariums wird es in Zukunft möglich sein, für die einzelnen Interpretationsperspektiven Modalstrukturen der hier subsumierten Untersuchungsteilnehmer/innen auszuarbeiten, die dann den überindividuellen Verstehenshorizont abzubilden gestatten.
In bezug auf die zweite Erkundungsfrage, den Zusammenhang von Interpretationspräferenzen und Geschlechterorientierung, fällt zunächst auf, daß die psychoanalytische Interpretationsperspektive am seltensten verfolgt wird (und wenn, dann vor allem von feminin/androgyn Orientierten). Psychoanalytisch Sozialisierte werden dies nicht verwunderlich finden, da wie gesagt mit der angewandten Methode ja nur reflexionsfähige Kognitionen erfaßt werden (sollen). Von außerhalb der Psychoanalyse liegt u.U. auch der Eindruck nahe, daß die entsprechenden Interpretationskonzepte zum Teil etwas abstrus anmuten, es sei denn, man kennt sie aus anderen Zusammenhängen, wie dies u.U. für die feminin/androgyn Orientierten angenommen werden kann.
Relativ plausibel interpretierbar erscheint mir der Zusammenhang zwischen existentialistischanthropologischer Perspektive und den indifferent Geschlechterorientierten. Denn für diese Interpretationsperspektive ist die Geschlechterproblematik praktisch nur ein Manifestationsbereich, an dem sich generellere anthropologische Probleme (wie die zwischen Natur und Gesetz) abarbeiten lassen und daß dies den weder besonders feminin noch maskulin Orientierten am nächsten liegt, ist unmittelbar nachvollziehbar.
Am überraschendsten dürfte sein, daß der feministische Interpretationsansatz nicht nur von feminin/androgyn Orientierten, sondern auch von maskulin Orientierten am meisten präferiert wird. Hier muß eine weitere qualitative Analyse der individuellen Interpretationsschaubilder klären, ob sich für die unterschiedlichen Orientierungskategorien evtl. verschiedene Schwerpunkte, Bewertungen etc. innerhalb des feministischen Interpretationsansatzes auffinden lassen.
Appelt, H. & Nutz, M. (1992). Erläuterungen und Dokumente: Heinrich von Kleist: Penthesilea. Stuttgart: Reclam.
Dann, H. D. (1992). Variation von LegeStrukturen zur Wissensrepräsentation. In Scheele, B. (ed.), StrukturLegeVerfahren als DialogKonsensMethodik (pp. 341). Münster: Aschendorff.
Hoverland, L. (1980). Heinrich von Kleist and Luce Irigaray: visions of the feminine. Amsterdamer Beiträge zur Neueren Germanistik 10, 5782.
MüllerSeidel, W. (1981). Penthesilea im Kontext der deutschen Klassik. In Hinderer, W. (ed.), Kleists Dramen. Neue Interpretationen (pp. 144171). Stuttgart: Metzler.
Pfeiffer, J. (1986). Kleists Penthesilea. Eine Deutung unter den Aspekten von narzißtischer und ödipaler Problematik. In Schöne, A. (ed.), Kontroversen, alte und neue. Akten des VII. Kongresses der internationalen Vereinigung der germanistischen Sprach und Literaturwissenschaft. Bd. 6 (pp. 196202). Tübingen: Niemeyer.
Runte, A. (1995). Liebestraum und Geschlechtertrauma. Kleists Amazonentragödie und die Grenzen der Repräsentation. In Härle, G. (ed.), Grenzüberschreitungen (pp. 295305). Essen: Die Blaue Eule.
Scheele, B. (1988). RekonstruktionsAdäquanz: DialogHermeneutik. In Groeben, N., Wahl, D., Schlee, J. & Scheele, B., Das Forschungsprogramm Subjektive Theorien (pp. 126179). Tübingen: Francke.
Scheele, B. (1990). Emotionen als bedürfnisrelevante Bewertungszustände. Grundriß einer epistemologischen Emotionstheorie. Tübingen: Francke.
Scheele, B. (ed.) (1992). StrukturLegeVerfahren als DialogKonsensMethodik. Ein Zwischenfazit zur Forschungsentwicklung bei der rekonstruktiven Erhebung Subjektiver Theorien. Münster: Aschendorff.
Scheele, B. & Groeben, N. (1984). Die Heidelberger StrukturLegeTechnik (SLT). Eine DialogKonsensMethode zur Erhebung Subjektiver Theorien mittlerer Reichweite. Weinheim: Beltz.
Scheele, B. & Groeben, N. (1988). DialogKonsensMethoden zur Rekonstruktion Subjektiver Theorien. Die Heidelberger StrukturLegeTechnik, konsensuale ZielMittelArgumentation und kommunikative FlußdiagrammBeschreibung von Handlungen. Tübingen: Francke.
Scheele, B., Groeben, N. & Christmann, U. (1992). Ein alltagssprachliches StrukturLegeSpiel als Flexibilisierungsversion der DialogKonsensMethodik. In Scheele, B. (ed.), StrukturLegeVerfahren als DialogKonsensMethodik (pp. 152194). Münster: Aschendorff.
Schreier, M. (1997). Die Aggregierung Subjektiver Theorien: Vorgehensweise, Probleme, Perspektiven. Kölner Psychologische Studien, II, 1, 3771
Stephan, I. (1984). »Da werden Weiber zu Hyänen...« Amazonen und Amazonenmythos bei Schiller und Kleist. In Dies. & S. Weigel (ed.), Feministische Literaturwissenschaft (pp. 2342). Berlin: ArgumentVerlag.
Wahl, D. (1979). Methodische Probleme bei der Erfassung handlungsleitender und handlungsrechtfertigender Subjektiver psychologischer Theorien von Lehrern. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie 11, 208217.
Wiese, B., v. (1952). Tragische und märchenhafte Existenz bei H. von Kleist. In Ders., Die deutsche Tragödie von Lessing bis Hebbel (pp. 309326). Hamburg: Hoffmann & Campe.